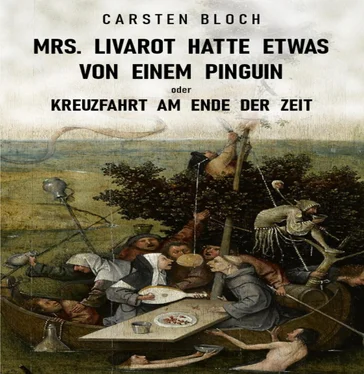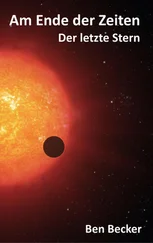Schließlich verabschiedete sich der Kapitän mit einem Hinweis auf unabdingbare Verpflichtungen. Er überließ seine beiden Gäste dem Schiff und jeweils einem Gin-Tonic an der Lido-Bar auf Kosten des Schiffs. Nachdem sich der Kapitän zurückgezogen hatte, verlor auch Livarot das Interesse, zusammen mit ihrem Schützling nach weiteren Sympathiepunkten für die Jafet zu suchen. Es drängte sie vielmehr in den zwischenzeitig erwähnten Fitnessraum, um der dort wartenden Mrs. Chester über ihre intensive Begegnung mit dem Kapitän zu berichten. Daher leerte sie ihr Glas in einem Zug und erklärte Marie kurz, wie sie zurück in ihre Kabine finden würde. Dann verschwand sie in einem der Gänge, die ins Innere des Schiffs führten.
Marie, allein zurückgeblieben, konnte sich weder für den Geschmack ihres Longdrinks begeistern, noch wollte sie sich auf den Weg zurück in ihre Kabine begeben. Zu lange hatte der Himmel für sie aus einer weiß getünchten, mit Stuck verzierten Zimmerdecke und die Sonne aus einem überdimensionalen Kronleuchter bestanden. So ließ sie ihr nur zur Hälfte konsumiertes Getränk zurück und spazierte an den Aufbauten der Jafet entlang Richtung Bug. Abseits der von den Passagieren üblicherweise in Anspruch genommenen Örtlichkeiten beugte sie sich über die Reling, um ihre Lungen mit dem Duft des Meeres zu füllen. Sie betrachtete die entfernte felsige Küste mit ihren blassgrünen Flecken auf ockerfarbenem Untergrund, betrachtete das Meer, das seine weiße Gischt wie ein Werfer an den felsigen Schlagmännern vorbeizuwerfen versuchte. Das Wasser war von tiefem Blau, doch wenn man sich anstrengte und senkrecht hinabschaute, war es glasklar und man konnte den bewohnten Untergrund sehen. Die Fische, die nach einem harten Arbeitstag nach Hause kamen, und die Krebse, die Nachtschicht hatten und sich gerade ihre schlaftrunkenen Fühler putzten. Das Schiff zerteilte mühelos die Wellen, die auf seinem Weg lagen.
Die Welt lag in Trümmern, hatte man ihr erzählt. Vielleicht war dieses Schiff mit seinen Bewohnern alles, was geblieben war. Und ein Gott oder ein Zufall hatte sie zu einem Teil der Schiffsbewohner werden lassen. Ihr war ein neues Leben geschenkt worden, nachdem sie in den letzten Wochen durstig und hungrig auf ihrem halb zerstörten Kutter längst mit dem alten Leben abgeschlossen hatte. War ein Wunder geschehen? Hatte ein mitleidiger Gott seine Macht genutzt und das Meer gegen seine Gewohnheiten gezwungen, ein bereits geschenktes Leben zurückzugeben? Ein Gott, der mit den Menschen fühlte, weil vielleicht auch er, als er noch klein war, manchmal ohne Abendessen ins Bett geschickt worden war?
Nein, an so etwas wie übernatürliche Wunder mochte Marie nicht glauben. Ihr Großvater hatte ihr erzählt, dass es keine Wunder gab. Alles war die Folge von logischen Zusammenhängen: die Strömungen der Meere, die Züge der Fischschwärme, das Wetter. Auch wenn man manches nicht verstand, folgte alles bestimmten Regeln, den Naturgesetzen. Und wieso sollte ein Gott ein Wunder geschehen lassen und den Naturgesetzen widersprechen? Er selbst hatte diese Naturgesetze geschaffen, damit alle sich daran hielten, und wenn er sich das Recht herausnahm, seine eigenen Gesetze zu übertreten, dann war er kein guter Gott, sondern ein böser Tyrann. Nur Tyrannen brachen die eigenen Gesetze.
Marie glaubte lieber an einen guten Gott, der bodenständig genug war zu wissen, dass selbst Göttlichkeit etwas Vergängliches war. Es war also kein Wunder, sondern ein Zufall gewesen, der ihr das Leben gerettet hatte, ein ganz simpler Zufall. In der Gestalt von Livarot. Ein kleiner Zufall hatte ihr ein Leben geschenkt, während zur gleichen Zeit vielen anderen das Leben genommen worden war. Marie wusste nicht, ob sie über die Lage der Dinge glücklich oder traurig sein sollte. Oder beides zugleich.
„Es ist selten, dass jemand hier an Bord auf das Meer hinausschaut“, unterbrach eine Stimme ihre Gedanken.
Marie wandte sich erschrocken um und sah einen jungen Mann, eher klein und hager, leicht lockiges kastanienfarbenes Haar, große, dunkle Augen, Haut mit einem leichten Gelbstich. Seine Kleidung war abgewetzt und so unpassend zusammengestellt, dass er unmöglich ein Passagier der Jafet sein konnte. Er lächelte sie mit seinem breiten Mund an.
„Die meisten Passagiere stellen ihre Liegestühle so, dass sie auf den Tennisplatz oder den Pool blicken können“, sagte der Mann und stellte sich neben Marie an die Reling. „Sie mögen das Meer nicht.“
„Mrs. Livarot hat auf das Meer geschaut, als sie mich entdeckt hat“, wandte Marie ein.
„Das ist wahr. Sie macht das jedes Mal, wenn sie ungestört Kekse essen will“, erwiderte der Mann. „Sie fühlt sich unbeobachtet, wenn sie sich an die Reling stellt.“
Marie empfand diesen Blickwinkel auf ihre Lebensretterin als ungerecht, doch sie erwiderte nichts. Sie betrachtete die Wellen, die singend ihre Gischt gegen den Rumpf des Schiffes warfen.
„Ich bin auf dem Meer zu Hause. Vermutlich mag ich es deshalb“, sagte sie stattdessen. „Mrs. Livarot und die anderen sind vom Festland. Ansonsten würden sie das Meer sicher auch lieben.“
„Ich liebe das Meer, seit ich es das erste Mal gesehen habe“, sagte der Mann, ohne Marie anzublicken. Zwischen den Wolken tropften die Strahlen der tief stehenden Sonne wie Honig. Der Wind tanzte auf den Kronen der Wellen.
„Sind die von dir?“, fragte Marie unvermittelt und zeigte auf ein paar provisorische Angeln, die mehrere Schritte von ihr entfernt an die Reling gebunden waren und deren Schnüre ins Wasser hingen und neben dem Schiff durch die Wellen gezogen wurden.
Der Mann nickte.
„Was benutzt du als Köder?“
„Stücke von einem Fisch, der so ungeschickt war, sich fangen zu lassen“, erwiderte der Mann.
„Wie viel fängst du auf diese Weise?“
„Nicht viel. Zwei oder drei Fische am Tag. Es reicht für Fischsuppe einmal pro Woche.“
Marie betrachtete belustigt die Angelruten, die scheinbar aus zusammengesteckten Gardinenstangen bestanden, an deren Enden Wollfäden gebunden waren. Sie glaubte, dass der Mann maßlos übertrieb. Wenn er mit diesen Angeln einen Fisch am Tag fing, dann war er gut.
„Du solltest es mit Netzen versuchen, wenn du mehr fangen willst“, sagte sie. Sie selbst hatte zwar keine Netze mehr benutzt, seit sie allein aufs Meer hinausgefahren war, weil die Handhabung für eine einzelne Person zu schwierig war. Sie hatte in dieser Zeit lange Leinen ausgeworfen, an denen in regelmäßigen Abständen Dutzende von Ködern angebracht waren. Auf diese Weise hatte sie zwar weniger gefangen, doch dieser Nachteil wurde durch die höheren Preise ausgeglichen, die in den Markthallen für diese Fische bezahlt wurden. Netze beschädigten die Haut der Fische, und in den Nobelrestaurants in den Städten bevorzugte man Fische mit gesunder Farbe und unbeschadeter Haut, und das ließ man sich etwas kosten. Dennoch waren Netze allemal effektiver als diese Angeln im Heck der Jafet.
„Ich glaube, wir haben keine Netze“, erwiderte der Mann.
„Wenn du dickes Garn an Bord findest, kann ich dir daraus Netze knüpfen, wenn du willst. Ich weiß, wie das geht.“
„Falls ich so etwas finde, komme ich gern darauf zurück. Vielen Dank für das Angebot.“
Eine der in letzter Zeit selten gewordenen Möwen flog vor ihnen her und schwebte in der Luft und dachte sich ihren Teil, was auch immer Möwen denken mochten beim Anblick zweier sinnlos umherstehender Menschen.
„Wohin fahren wir eigentlich?“, fragte Marie nach einiger Zeit.
„Wir folgen der Küste“, erwiderte der Mann. „Wenn wir Glück haben, treffen wir auf einen Hafen, der die Katastrophe überstanden hat, und können dort auftanken. Es scheint, dass wir nicht mehr viel Treibstoff haben.“
Im Westen senkte sich die Sonne über den Horizont und küsste das Meer, ohne ein Wort zu sagen. Die Dämmerung begann, sacht wie ein Schleier vom Himmel zu schweben.
Читать дальше