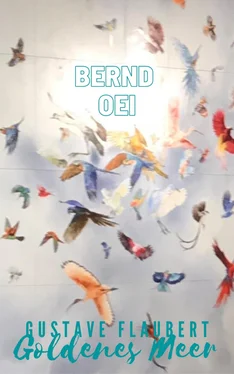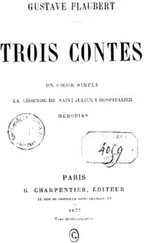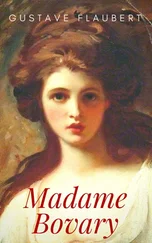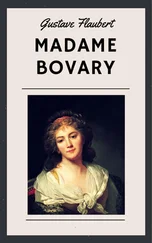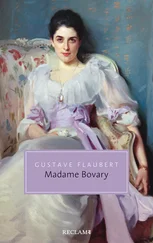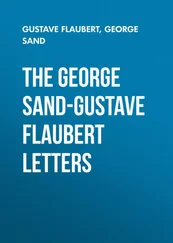Flaubert macht die Erfahrung, sein Traum als auch die Poesie bleiben von der Herrschaft ausgespart. Der Rückzug ins Innere wird so zu seinem übersteigerten Raum der Freiheit. „ Auf dem Umweg eines möglichen Selbstmordes gewinnt das Kind seine Existenz aus sich selbst.“15 Suizidfantasien transformieren sich mit der Zeit in sexuelle Unterwerfung, die sich in lethargischen männlichen Protagonisten und dominanten Frauentypen widerspiegelt Flaubert, der „ ständig von der Revolte träumt“, schiebt sie durch seine Passivität nur auf.
Die Erlösung folgt durch die unheilbare Krankheit der Epilepsie; das traumatisierte Individuum flüchtet sich in diese Krankheit. In der autobiographisch gefärbten Erzählung „November“, fallen Sätze wie: „ Er dachte einen Augenblick daran, ob er nicht Schluss machen sollte“ Flaubert transformiert seine Selbstentfremdung in eine „unaufrichtige Unterwerfung“; er kokettiert mit dem Suizid als eine Freiheit, an die er im Grunde gar nicht glaubt. Für Sartre gefällt er sich wie viele von der Februar-Revolution Enttäuschte in der Rolle des Opfers,
Der Hass auf das Bürgertum ist folglich Selbsthass mit einem Vaterkonflikt als biografische Beigabe. Durch Verzichtet auf alles, was dem Vater gefallen würde, schadet sich der junge Autor selbst und bleibt trotz seines Künstlertums ein Bourgeois. Er verwirft sozialen Aufstieg, Karriere, Engagement, doch nur, um sich zu Hause zu langweilen: „ Außerhalb des Familienentwurfs, in dem er sich entfremdet hat, gibt es bei Gustave keinen wirklichen primären Entwurf, er verweigert sich ... er ist einfach krank, faul und projiziert sich nur noch im Schreiben .“ Die Folgen sind Fatalismus und Abwertung der anderen, auf die Flaubert stets als Dilettanten herabschaut. Dabei verurteilt er sich zur Passivität. Mit Sätzen wie: „ Ich bin nicht geschaffen um zu leben “ entwirft sich der Zwanzigjährige negativ, d.h. als machtlos gegenüber seinem stets wachsenden Unglück, das er selbst nährt. Dabei entsteht eine weibliche, an Madame Bovary erinnernde Grundhaltung, „ alles bis zum Schlimmsten zu durchleiden “ und somit aus der Schwäche eine Tugend zu machen.
Hinter seiner Passion für das Altgriechische und Latein und der Weigerung, Shakespeare zu lesen, steht die Faszination der Ananke; Flauberts Kult, alles schicksalhaft und zwanghaft zu erleben. Dass er Momente der Erinnerung einfriert und alles vermeidet, um diese zu überprüfen oder etwas zu wagen scheint eindeutig, denn die erschaffene Traumwelt zeitigt keine Helden, sondern im Grunde nur Narren und Träumer, was für Sartre auf dasselbe hinausläuft. Hinter dem sich das Bedürfnis nach Ohnmacht verbirgt. Die Faszination für Okkultismus (Ägyptologie, Swedenborg) zeitigt einen bizarren Synkretismus mit der bereits jugendlich rezipierten Antike und Katholizismus.
Ein Hang zur Transsexualität die Frauenrolle, weil er sich mit ihrer unterdrückten Art und devoten Rolle identifiziert. Bereits seine erste Frauenfigur Marguerite in der Erzählung „Un parfum à sentir“ (1836), das noch im romantischen Stil gehalten ist und nichts von seiner Originalität verrät, spielt, wie der Titel verrät, mit der Doppeldeutigkeit der Sprache: sentir inkludiert riechen, empfinden, erinnern – der Duft amalgiert die drei Tätigkeiten, die allesamt rezeptiv sind. Die Handlung nimmt Madame Bovary vorweg: eine unglückliche Frau verliert sich zunehmend in einer Traumwelt, am Ende begeht sie Suizid.
Die Eigenschaften (plump, hässlich, voller Angst und Lebensekel) spricht er sich selbst zu. Sartres Maxime lautet: „ Man muß handeln, um zu sein “; Flauberts könnte lauten: „Man muss träumen, um zu vergessen, wer man ist.“ „ Diese gefestigten Träume ersetzten die unmögliche Revolte: er stillte in ihnen irreal seine sexuellen Triebe.“ 16Flauberts künstlerisches Sendungsbewusstsein fordert die totale Identifikation mit der Kunst und das religiöse Opfer an sie.
Nach dem Balbutismus stellt sich im Alter von 22 Jahren Epilepsie ein, die Flaubert in reiferen Jahren voraussehen und sogar beeinflussen kann. Die Krankheit gewährt ihm alle Freiheiten. „ Diederich Heßling ist ein ängstliches und sensibles Kind, das dennoch seine ebenso zarte Mutter für ihre Schwäche verachtet.“ Der erste Satz aus Heinrich Manns „Der Untertan“ könnte nicht treffender Flaubert portraitieren, dessen betont männliches Auftreten auf Imponiergehabe und Kompensations-Aggressivität hinausläuft. Dies gilt auch für seinen kultivierten Hass auf die Bourgeoisie als Spießertum, das er doch selbst in Vollendung praktiziert: „ An die Stelle der Dialektik von Haben und Sein wird er die Frage von Sein und Tun setzen.“
Flaubert wählt bevorzugt Passivkonstruktionen: „ sich schreiben lassen “ anstelle von lesen oder „ sich arbeiten lassen “, wenn er das Gelesene reproduziert. Äußerlich bildet der Orient, innerlich der weibliche Eros das Zentrum seiner Idealisierung, die zugleich eine Illusion von der makellosen Schönheit ist. Man liebt nur, woran man leidet, schreibt Flaubert und Makellosigkeit liefert eine unstillbare Sehnsucht, traurig wie eine glückliche Erinnerung.
Die Rezeption von 27 historischen Studien zu „Salambô“ steht in keinem Verhältnis zu den Recherchen eines Romanciers über seinen Stoff. Sartre hält Flaubert für einen notorischen Sammler, der nach Vollkommenheit strebt. Was Hegel in der Vernunft verabsolutiert und Marx im Kapital wird für den Schriftsteller aus Rouen die Kunst der Improvisation auf der Basis von Wissenschaft. Bestes Beispiel für die Engführung von Fantasie und akribischer Suche des Details liefert seine Begegnung mit Elisa Foucault, der Frau seines Lebens, der vielleicht einzigen, die er liebt. Flaubert lebt, um von ihr zu träumen und sich an sie zu erinnern, nicht, um mit ihr zu leben oder um sie zu kämpfen. Elisa Schlésinger bleibt nur im Traum oder im Verzicht auf ein gemeinsames Glück Quelle für Inspiration. Flaubert gesteht seinem Intimus Maxime du Camp, „ daß er sie nicht liebte, solange sie seine Träume in makelloser Schönheit durch ihre lästige Gegenwart störte.“ Die reale Liebe erscheint ihm banal.
Sartre wendet auf Flaubert wiederholt hegelianische Dialektik aus dem Kapitel „ unmittelbares und mittelbares Selbstbewußtsein “ an, und verteilt diese Abstraktionen auf Herr (Selbst, Subjekt) und Knecht (Bewusstsein, Objekt) in dem Schriftsteller. „ Die geduldige Negation des Knechts durchdringt und verwandelt also nicht nur die Ethik des Herrn, sondern eher der Knecht produziert den Herrn.“ Flauberts Bewusstsein reproduziert durch seine literarische Arbeit den Autoren und subsituiert Leben vollkommen durch den Traum. Der Sinn des Lebens besteht darin träumen zu können, um darüber zu schreiben.
Poesie impliziert das reine „ für sich sein “, der Autor wird Gott, verweigert sich in der realen Existenz. Der unendliche Konjunktiv totalisiert sich ausschließlich im Schreiben. Besonders seine Briefen an Louise Colet untermauern die orgiastische Freude am kreativen Prozess „ Man muß korrekt und genau schreiben und rasend und leidenschaftlich“ Die Form entspricht dem Traum, der Stoff dem Leben; folglich ästhetisiert Flaubert die Banalität. Keine seiner Geschichten glänzt durch Originalität und das Grundmotiv wiederholt sich, doch diese Langeweile füllt der Autor mit einer beispiellosen Schönheit seiner Vorstellungskraft und Wortfindungskunst. Nur die Imagination erlaubt Vollkommenheit.
Man muss sich an Details abarbeiten um in die Dingwelt sich einzuschreiben. Nichts ist schlimmer als etwas nicht vollkommen schön zu sagen. Melancholie und Langeweile sind grundbestimmend; fatras und ennui bilden existenzielle Grundlagen für Flauberts Flucht in die „ Phantasmagorie“ .
Читать дальше