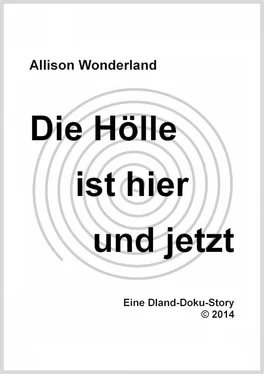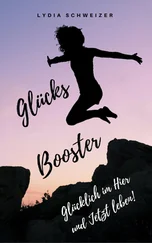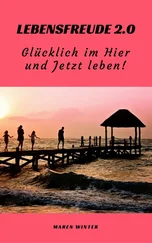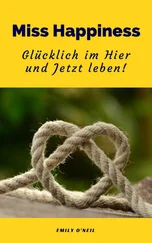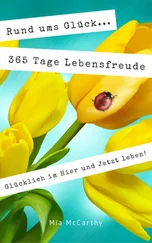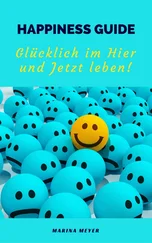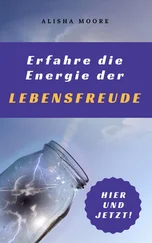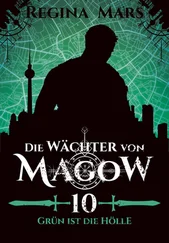Wenn Sie verstehen wollen, warum er nichts anderes im Kopf hatte, wenigstens in seiner Freizeit, sollten Sie unbedingt diesen absolut großartigen Roman lesen, mein Lieblingsbuch‚ das „Portnoys Beschwerden“ heißt.
Geschrieben hat die Geschichte ein Mensch, der meinem Erzeuger übrigens wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich sieht. Jedenfalls hat er, Philip Roth, allen von ihren herrischen Müttern chronisch gebeutelten jüdischen Söhnen damit ein Denkmal gesetzt. Mir ist natürlich klar, es muss Ihnen wahrscheinlich reichlich seltsam vorkommen, dass jemand den eigenen Erzeuger durch irgendein Buch erklärt, und es macht mir auch gar keinen Spaß, in dieser Weise über meinen Erzeuger zu sprechen, aber so liegen die Dinge nun einmal. Ich sollte Sie auch warnen. Wenn Sie „Portnoys Beschwerden“ in die Hand bekommen, sollten sie drauf achten, beim Lesen weder zu essen noch zu trinken. Wegen der ständigen Möglichkeit, dass sie sich vor Lachen verschlucken könnten. In diesem Buch steckt all das Lachen, das ich Ihnen in meiner verdammten Dokumentation leider nicht bieten kann. Dafür will ich Sie wenigstens etwas entschädigen. Schade ist auch, dass die deutschsprachige Auflage des Romans gradezu lächerlich niedrig ist. Man könnte sie direkt mickrig nennen. Es konnten bis heute ungefähr so viele Exemplare verkauft werden, wie Juden in Deutschland wohnen. Die anderen Leute wollen mit der Story wenig oder am liebsten überhaupt nichts zu schaffen haben, weil sie sich vor ihr fürchten. Ich meine, „Portnoys Beschwerden“ beschreibt nämlich das Alltagsleben einer stinknormalen jüdischen Familie, die zwar im Großraum New York wohnt, und Philip Roth beschreibt auch nur die 30er bis 60er Jahre, aber es geht darum, WIE er alles beschreibt, nämlich extrem lebensecht und alles, und genau davor haben die meisten Deutschen Angst. Besonders die mit dem schlechten Gewissen.
Warum, ihre Väter gingen damals her und degradierten die Juden systematisch zu Untermenschen, woraufhin die Nazikinder und -enkel sich auch in dieser Hinsicht möglichst demonstrativ von ihren Vorfahren distanzieren wollen. Das tun sie, indem sie jetzt die Juden zu absoluten Übermenschen stilisieren und sich vor lauter pathetischem Philosemitismus überschlagen. Wenn man hergeht und ihnen „Portnoys Beschwerden“ schenkt, wissen sie sich nicht zu fassen vor lauter Empörung, weil der Autor sich und seine Familie so beschreibt, wie Menschen eben sind: einfach stinknormal nach außen hin, und hinter der Fassade bürgerlicher Anständigkeit leicht bis mittelschwer überdreht. Also, man sollte das wirklich unbedingt lesen, wie Portnoy auf der Couch eines Psychiaters liegt, der, nein, nicht Phil Baumgartner‚ sondern Spielvogel heißt, und wie er aus dieser demütigen Rückenlage seine eigene Kindheit und Jugend durchhechelt. Zum Beispiel die Szene, in der Portnoy jun. seinen Vater, der an chronischer Verstopfung leidet, auf der Toilette hockend vorfindet, schlafenderweise, total erschöpft nach dem einzigen Kraftakt des Tages, zu dem dieser arme Mann noch fähig ist, weil nämlich seine Frau mit ihrem dominanten Wesen ihm immer das letzte bisschen Wind aus den Segeln nimmt. Anders der kleine, langsam größer- und geschlechtsreif werdende Sohn der beiden, Al.
Das entsetzliche Gehabe seiner Mutter (am heimischen Herd) setzt ihn nicht matt, sondern es treibt ihn an. Und wie es ihn antreibt. Es befeuert den guten Al gradezu. Wozu? Nun, ganz einfach: blondbezopften Gretls hinterher zu laufen. Selbige werden auch „Schicksen“ genannt und geschimpft. Eben von der cholerischen Mama Portnoy.
Ohjunge, in den USA machte diese Story ihren Autor buchstäblich über Nacht zum Millionär. Hinsichtlich der Buchauflage wie auch in Sachen Geld. Die Leute, besonders die Juden natürlich, von denen damals im Großraum New York mehr lebten als in ganz Israel, rissen den Buchhändlern die druckfrischen Exemplare gradezu aus den Händen. Und nicht zuletzt natürlich wegen der (ich zitiere einen Rezensenten) „... unbefangenen Schilderung sexueller Aspekte.“ Aber, verstehen Sie, das stammt aus dem Jahr 1969, als „Portnoy“ herauskam. Im puritanischen Nordamerika. Damals war noch längst keine Rede davon, dass das „Penthaus-Magazin“ es riskieren konnte, süße Schwesterchen so photographieren zu lassen wie zehn oder zwölf Jahre später.
Diese blonden Gretls. In der Story dann auch als „Schicksen“ bezeichnet bzw. beschimpft, weil sie eben Wert darauf legen, chic auszusehen, mit Makeup und in Nylons und mit hochhackigen Schuhen. Alles logischerweise Accessoires, die ein braves jüdisches Mädchen nicht hat und ablehnt. Oder vielmehr: per Erlass ihrer überdrehten Mutter abzulehnen hat.
Nach Al Portnoys vielfach (mit zunehmend schriller werdender Stimme) geäußerter Mutmaßung ist es wiederum die Bestimmung eines braven jüdischen Jungen, mehr oder weniger ausgeprägt als Eunuch geboren zu werden und auch als solcher zu leben und zu sterben. Oder wenn schon nicht als Eunuch, dann wenigstens als ausgemachter Waschlappen.
Das Dasein von Portnoy jun. gleicht darum einem einzigen Ritt mit der Lanze (Lanze?) gegen die Windmühle dieser von religiösen Traditionen vorbestimmten Rolle. Und was tut er also? Er tut natürlich, was am nächsten liegt: von panischer Verzweiflung gejagt (und von seiner Mama sowieso), knöpft er seine Hose auf und präsentiert sich (was für ein Selbstbewusstsein) der weltweit versammelten weiblichen Zuschauerschaft.
Soll heißen: selbstverständlich nicht braven, neurotischen jüdischen Mädchen mit strengem Haarknoten, sondern eben den Schicksen.
Auf der Flucht vor seiner Mutter treibt deren grenzenloser Wahn, ihren Sohn zu beherrschen (und ihren Mann sowieso), unseren Freund Portnoy von einer blonden Gretl zur nächsten.
Wie er es mit eigenen Worten ausdrückt: „Heute habe ich diese hier in der Mache, aber morgen schon die andere, und übermorgen die nächste...“
Und immer so weiter. Bis zum großen Scherbengericht natürlich, mit dem jeder Wahn irgendwann endet. Aber das ist natürlich ein anderes Thema.
Seit ich also „Portnoys Beschwerden“ las, kann ich meinen Erzeuger viel besser verstehen. Ich meine, seitdem ich mich besser in ihn hineinversetzen kann und alles. Portnoy hat mir sozusagen meinen Erzeuger erklärt - seine Motive, warum er sich damals so verhielt, als er die Region zwischen München und Salzburg unsicher machte, um blondbezopfte Gretls auszuspähen. So wie schließlich auch meine Mutter. Die er sogar abschleppte, als er im Dienst war, weil sie ihm nämlich zufälligerweise als Sekretärin zugeteilt worden war. Sie kam für ihn sozusagen gratis und inklusive.
Sie sollten sich meinen Erzeuger natürlich auch nicht so vorstellen, wie man Vertreter seiner Berufsgruppe in irgendwelchen blödsinnigen Filmen präsentiert bekommt. Ich sagte ja, er hatte damals diese Sekretärin - wenn er nicht grade herumreiste‚ versah er seinen Job wie alle anderen auch vom Büro aus. Ich wette, als er vor dem Krieg als Dozent für politische Wissenschaften in Princeton arbeitete, dürfte sein Job bestimmt um einiges spannender gewesen sein. Nur dass es dort in der Nähe von New York, im Staat New Jersey, eben keine blondbezopften Gretls gab.
Die Großeltern meines Erzeugers wanderten dahin aus - 1906; ursprünglich wohnten sie in Tschernowitz. Diese Stadt bildete damals eine Art Außenposten der Habsburger Monarchie.
Mutter Singer muss so herrschsüchtig gewesen sein, dass ihr Sohn einen ausgewachsenen Weltkrieg brauchte, um endlich von ihr loszukommen. Er meldete sich, um für das O.S.S. zu arbeiten, also für Onkel Sams Geheimdienst im Krieg - alles nur, um endlich den blondbezopften Gretls hinterher hecheln zu können. Und in den 50er und 60er Jahren, als wieder Ruhe war in Europa und ein ganzer Ozean zwischen meinem Erzeuger und Mama S. lag, düste er eben mit seinem Supersportwagen herum und jagte Gretls. So lange, bis es einen Unfall gab - ich meine, bis ich eben plötzlich da war.
Читать дальше