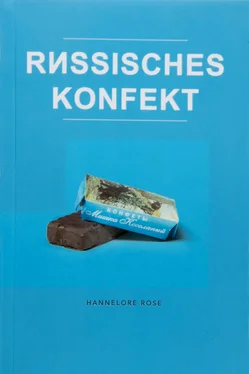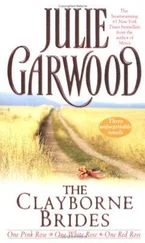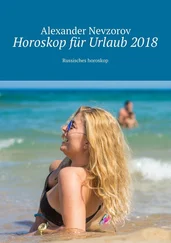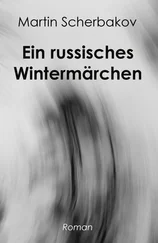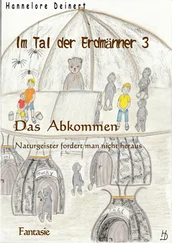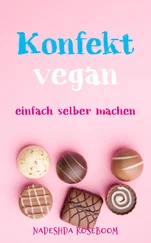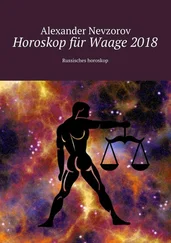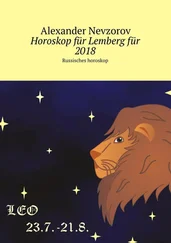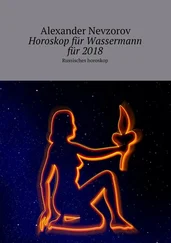Die Leute sagten oft, wenn sie nur das Geld von einem einzigen Tag hätten, das zum Beispiel die Düsenjets für Kerosin auf ihren Übungsflügen verbrauchten, dann wären sie „gemachte Leute“. Jeder von uns sah, welche Unsummen die Besatzungsmacht tagtäglich verschlang.
Uns war bekannt, dass wir die zu leistenden Reparationen zu 98 Prozent erbrachten. Mit der Übergabe von kompletten Werken oder Fabriken, die in Gänze abgebaut und in die Sowjetunion gebracht wurden, zahlten wir einen hohen Preis. Die genaueren Zahlen wurden erst nach der Wende öffentlich: 3000 Werks- bzw. Betriebseinrichtungen verließen Ostdeutschland. Somit war die Pro-Kopf-Belastung der ostdeutschen Bürger sechzig Mal höher, als die der westdeutschen Bevölkerung. Von westdeutschem Gebiet wurden über 600 Betriebe abgebaut. Der Westen wurde mit dem Marschall-Plan versorgt. Das Dilemma der Betriebe, die unser Territorium verließen war zudem, dass viele der abgebauten Maschinen und sonstigen Einrichtungen bei den Russen überhaupt nicht aufgebaut oder angeschlossen werden konnten. Es fehlten schlichtweg die Voraussetzungen dazu. So rosteten die Einrichtungen auf manchem Feld einfach vor sich hin. Es war ein Desaster.
Auf jeden Fall konnte sich ein russischer Offizier vor seiner Abreise gut mit allem versorgen, bevor es wieder zurück in die „kalte Heimat“ ging.
Als mein großer Sohn Christian zur Welt kam, besorgte mir meine Mutter einen guten Teppich aus dem Magazin. Dies ging nur unter Zuhilfenahme mehrerer Lageristinnen und der Leiterin des Magazinkontors. Es waren ja schließlich Waren für die russische Besatzungsmacht. Allerdings gab es immer Möglichkeiten, dass sich deutsche Angestellte ab und an einen guten Artikel kaufen konnten. Dieser wurde dann über ein kleines Magazin über die Warenliste verkauft. Eine nette Arbeitskollegin meiner Mutter sagte zu mir, als wir den Teppich in einen LKW packten: “Also Hannelore, dieses gute Stück muss erst eingeweiht werden“. Das passierte folgendermaßen: Sie rollte den Teppich auf den staubigen Boden des Lagers aus und lief mit ihren Straßenschuhen quer darüber. „So, nun ist er eingeweiht.“ Alle Lagerarbeiter applaudierten danach. Jetzt durfte ich den Teppich einrollen und zum LKW bringen. Es war ein schöner weinroter „Halbmond-Teppich“. Handgeknüpft aus Kaschmir.
Über die komische Verkaufskultur der sowjetischen Verkäuferinnen haben sich die deutschen Einwohner regelrecht kaputtgelacht. Sie trugen merkwürdige Häubchen, waren fast immer unfreundlich und hatten nicht selten ihre Zähne komplett mit Goldkronen versiegelt. Das sah sehr merkwürdig aus. Wir nannten sie die dicken Matroschkas. Auf der Straße trugen sie viel zu knappe Wintermäntel, wurstige Stiefel und lustige bunte, verfilzte Strickmützen. Auch schöne Ohrringe und Ketten aus dunklem Gold trugen sie. Für uns waren sie schon hunderte Meter entfernt gut erkennbar. Interessant waren zudem ihre Additionsmaschinen, der sogenannte Abakus, den sie in den Verkaufseinrichtungen nutzten. Sie bestanden aus einem Rahmen mit mehreren Zwischendrähten und verschiedenfarbigen ganzen Kugeln oder auch Halbkugeln. Diese waren schwarz und braun. Einige beige. Sie konnten jedenfalls mit diesen Gerätschaften derart geschickt umgehen, dass man sich nur wunderte. Die Rechenoperationen stimmten genau. Bewundernswert war aber auch die Geschwindigkeit mit der sie rechneten. Das war schon toll. Wenn meine Mutter mich mit einem Zettel losschickte zum Einkauf im Magazin, dann fassten die russischen Offiziersfrauen ständig meine Zöpfe an. Und da meine Haare immens dick waren, war ihre Bewunderung groß. Leider nervte dies. Ich habe die russischen Frauen freundlich und hilfsbereit erlebt., aber auch rustikal, trampelig und direkt.
Wenn ich an die russischen Frauen denke, dann fällt mir der Spruch meines Russischlehrers ein. Wenn jemand eine falsche Antwort gab dann sagte er: “Ach hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben.“ Es folgte dann Gelächter der Klassenkameraden und er freute sich diebisch.
Unangenehm war für mich immer, wenn ich im Magazin etwas einkaufen musste und Soldaten waren auch da. Sie hatten wenig Geld zur Verfügung. Mein Vater sagte einmal, sie bekommen fünfzehn MDN (Mark der deutschen Notenbank) pro Monat. Meist kauften sie sich Kekse oder irgendwelche Waffeln. Da viele von ihnen auch rauchten, echte russische Zigaretten, die zur Hälfte aus Pappe bestanden, dürfte das Geld nie ausgereicht haben. Mein Vater rauchte diese Zigaretten ebenfalls. Sie hießen Papyrus oder Belarus. Sie waren in einfachen weichen Pappschachteln mit blau-weißem Aufdruck verpackt.
In den letzten Jahren vor der Wende hatten die DDR-Bürger eine seltsame Vokabel erfunden. Diese lautete „Verrussifizierung“. Wir hatten Angst davor, noch mehr von den russischen Gewohnheiten, der Schlampigkeit und Gleichmacherei, sowie der militärischen Gewohnheiten zu übernehmen. Es war uns ein Graus.
In Jüterbog gab es aus dem Zweiten Weltkrieg einen speziellen Bahnhof mit einem sehr großen Bahnhofsgebäude (Jüterbog II) von dem aus nur russische Züge abfuhren. Hier habe ich auch einige Male Intercontinental-Raketen und BUG-Raketen auf offenen Güterwagons gesehen. Die darüber gespannten Planen waren vom Wind heruntergezogen. Die Offiziere bemühten sich, die Planen wieder neu festzuzurren. Das Bahnhofsgebäude hatte sogar einen komfortablen Lastenaufzug. Die Züge wurden teilweise dort eingesetzt und standen manchmal Tage vorher bereit. Es waren Sammelzüge, die aus mehreren Gegenden der Republik die sowjetischen Offiziere zusammenfassten. Wenn Soldaten ihre Militärzeit hinter sich hatten, wurden sie in Güterzügen befördert. Ein Personenzug kam für sie nicht in Frage.
Eine peinliche Geschichte ist mir einige Zeit nach dem Fall der Mauer passiert. Ich war nach der Währungsunion im Supermarkt Meyer einkaufen. Vor mir an der Kasse stand zu meinem großen Erstaunen ein russischer Soldat. Er trug diesen bekannten hässlichen langen Filzmantel. Für mich unverkennbar. Er war sehr dünn und machte einen richtig kranken Eindruck. Er kaufte sich eine Flasche Milch und wollte gerade bezahlen. Ich sagte der Verkäuferin, dass ich die Milch gerne mit bezahlen möchte. Kein Problem. Zu meinem großen Erstaunen entpuppte sich der „russische Soldat“ als ein Berliner Student, der mich auf der Stelle laut anschnauzte, warum ich denn seine Milch bezahlen wollte. Ich entschuldigte mich in aller Form, nannte ihm aber nicht den Grund. Ich war ja sowieso total perplex. Es war „in“ bei den Westberliner Studenten, sich Sachen und Gegenstände vom russischen Militär zu besorgen. Mäntel und Fellmützen waren ganz besonders beliebt. Wer gute Beziehungen hatte, besorgte sich sogar Waffen. Die Kalaschnikows wurden heiß gehandelt. Tatsächlich setzte das sowjetische Militär alles Erdenkliche in bare Münze um.
Es war 1971, als ich eines Morgens auf sehr glatter und regennasser Straße mit meinem Fahrrad zur Schule fuhr. Ich war aufgeregt, da eine Mathematik-Klassenarbeit bevorstand. Ich fuhr irgendwie mit einem Trabant zusammen, rutschte über die Straßenpflasterung und zog mir eine Gehirnerschütterung zu. Ich war einige Tage im Jüterboger Krankenhaus. Einen Tag bevor ich entlassen werden sollte, herrschte Bettennot. Ich konnte also einen Tag früher nach Hause. Ich packte meine Sachen und lief mit meiner schulbuchbeladenen Tasche durch die Stadt. Der Weg war weit. Da ich tatsächlich recht schwach war, fiel mir das Laufen schwer. Ich wollte zum Bahnhof. Dieser war aber noch drei Kilometer entfernt. Die Sonne brannte. Mich überholten einige russische Frauen, die mir sofort die Tasche abnahmen, einen Lkw anhielten - per Anhalter wurde oft gefahren - und mir auf die Ladefläche halfen. In Altes Lager angekommen leisteten sie mir wiederum Hilfe. Das habe ich nie vergessen. Sie waren irgendwie sehr kompakt und griffen immer zu, um zu helfen.
Читать дальше