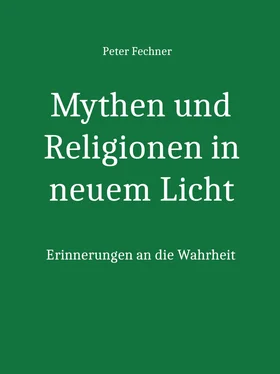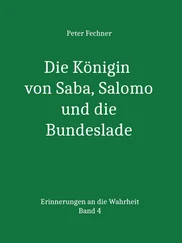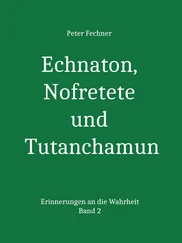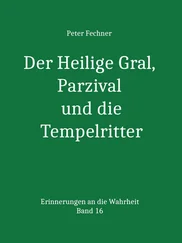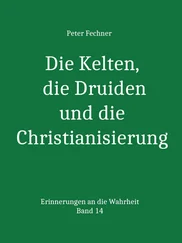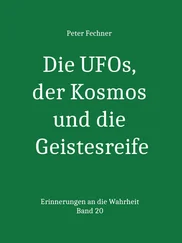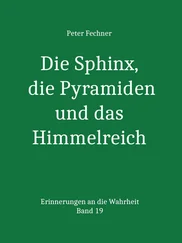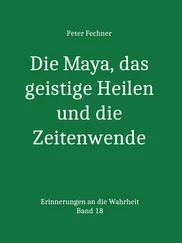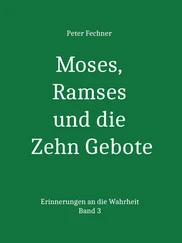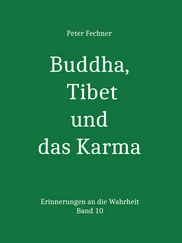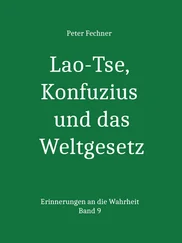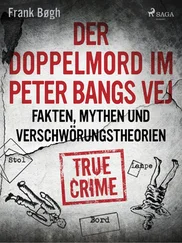Eje hoffte, wenn Tut-ench-Aton offiziell mit zwölf Jahren die Regierungsgeschäfte als Pharao übernehmen würde, auch den Glauben an den Einen Gott wieder einführen zu können. Tut-ench-Aton beabsichtigte, zum Zeitpunkt der Übernahme der Regierung auch die gleichaltrige Maket-Aton zu heiraten, mit der er zusammen aufwuchs. Doch die Königsmutter Anches-en-Amun wollte lieber später eine Frau ihrer Wahl für den Sohn suchen. Sie ließ ihre eigene Nichte kurz vor der Hochzeit von Re-Priestern „beseitigen“! Tut-ench-Aton war darüber so verzweifelt, dass er offensichtlich allen Lebenswillen verlor und offenbar einer seit der Geburt einwirkenden Krankheit nicht mehr genügend Kraft entgegensetzen konnte. Er verstarb kurz nach der Ermordung Maket-Atons eines „natürlichen“ Todes und wurde in dem von Howard Carter aufgefundenen Grab bestattet.
Kurz vor seinem Tod hatte Tut-ench-Aton noch Eje zu seinem Nachfolger als Pharao ernannt. Doch sein Amt konnte Eje offiziell erst antreten, wenn der verstorbene Pharao beigesetzt, die „Mundöffnungszeremonie“ im Grab durchgeführt, und das Grab mit dem Siegel des Verstorbenen geschlossen worden war. In der kritischen Zwischenzeit hätten auch Anwärter mit größeren Rechten Ansprüche auf das Pharaonenamt erheben können. Und so versuchten auch die Re-Priester der Königsmutter Anches-en-Amun heimlich einen Königssohn aus dem Hethiterreich als Gatten zu verschaffen. Die Briefe sind 1906 in der Türkei im Tontafelarchiv der ehemaligen hethitischen Hauptstadt Hattusa aufgefunden worden. Dieser Gatte hätte Vorrang vor Eje gehabt, dem die Re-Priester misstrauten. Aber die Hochzeit der Königsmutter Anches-en-Amun kam nicht zustande; denn dem hethitischen König war die Angelegenheit nicht ganz geheuer, wie man aus dem Seherbericht und auch aus dem aufgefundenen Tontafelarchiv entnehmen kann. Tut-ench-Aton wurde unter seinem offiziellen Namen Tut-ench-Amun Nebcheprure nach den gemäß Bestattungsritus vorgeschriebenen 70 Tagen ganz offensichtlich in größter Eile bestattet, und Eje blieb Pharao.
Aber nur vier Jahre lang. Dann schlugen die Re-Priester wieder zu; denn Eje und viele seiner Anhänger hatten sich nun auch wieder öffentlich zu Gott bzw. Aton bekannt. Die Priester räumten Eje aus dem Weg und setzten den treulosen Haremhab als Pharao ein. Jeder Aufruhr wurde jetzt mit Gewalt unterdrückt, und alle vorhandenen Bauwerke, die nur irgendwie an die Amarna-Zeit erinnerten, wurden von ihm und den nachfolgenden Pharaonen, den Ramessiden, systematisch zerstört. Die Namen der Könige Ech-en-Aton, Semenchkare, Tut-ench-Amun und Eje wurden auf Statuen und Tafeln weitgehend ausgemeißelt und auch nicht in die offiziellen Königslisten aufgenommen. Gebrochene Reliefs aus den Aton-Tempeln hat man als Füllmaterial für neue Tempelanlagen benutzt. Sie wurden erst im 20. Jahrhundert Stück um Stück wiederentdeckt. Alle Vertuschungsversuche, die lichte Amarna-Zeit in Vergessenheit sinken zu lassen, waren aber letztlich vergebens. Die Wahrheit kam nach über 3.000 Jahren doch noch an das Tageslicht.
Dreifache Königsbestattung
Eje hatte als nachfolgender König die Bestattung des Knaben-Königs nach alter ägyptischer Tradition durchgeführt – und dabei die Erinnerung an die Amarna-Zeit unter Ech-en-Aton aufrechterhalten. Als Howard Carter 1922 das Grab des Knaben-Königs öffnete, stellte er fest, dass der Vorraum und die Nebenräume zwar durchwühlt worden waren, dass aber die meisten Grabbeigaben noch vorhanden waren. Auch die ursprünglichen Siegel der Schreine waren unbeschädigt. Umhüllt von vier vergoldeten Schreinen, einem steinernen Sarkophag und drei menschenförmigen Särgen, die den König als Gottheit darstellen sollten, lag unberührt die bandagierte Mumie mit der Goldmaske. Im wahrsten Sinne des Wortes wurde die Mumie „entdeckt“ – von ihren Hüllen befreit.
Im Grab des Knaben-Königs gab es vier ineinander gesetzte große Schreine, die den Sarkophag umhüllten, wobei die drei inneren Schreine deutlich durch ein abgrenzendes Sternentuch vom äußeren Schrein getrennt waren. Dieser sehr große äußere Schrein diente – soweit heute bekannt ist – bei dem sogenannten Sed-Fest als „Versammlungsschrein“ der Ahnen und Götter. In ihm traf sich der König nach normalerweise dreißig Regierungsjahren symbolisch mit Ahnen und Göttern und verließ ihn anschließend wieder – in der Glaubensmeinung mit neuer Kraft aufgeladen –, um weiter erfolgreich regieren zu können. Die drei inneren Schreine deuten darauf hin, dass in diesem Fall auch drei Könige gewürdigt werden sollten, nämlich sowohl Tut-ench-Amun als auch die beiden Amarna-Könige Ech-en-Aton und Semenchkare. Bei den äußerst beengten räumlichen Verhältnissen in der Sargkammer hätte es sich ansonsten angeboten, nur einen einzigen Schrein zu benutzen.
Der junge König lag in einem Sarg aus massivem Gold – ummantelt von zwei vergoldeten Holzsärgen, die sich wiederum in einem steinernen Sarkophag befanden. Der Sarkophag stammte vermutlich aus dem Grab KV 55, wo er nachträglich entfernt worden war. Nach Angaben von Ägyptologen ist der Sarkophag umgewidmet worden und soll ursprünglich für Nofretete angefertigt worden sein, die gemäß dem Seherbericht von Eje ganz schlicht und ohne Sarkophag an unbekannter Stelle bestattet worden war. Der äußere Sarg trägt vermutlich eine Abbildung des Königs Ech-en-Aton, der mittlere Sarg eine Abbildung seines Mitregenten Semenchkare, und nur der innere, massiv-goldene Sarg zeigt den verstorbenen jungen König Tut-ench-Amun bzw. Tut-ench-Aton. Die beiden Amarna-Könige Ech-en-Aton und Semenchkare, deren Leichname nicht erhalten geblieben waren, hatten somit durch Eje heimlich doch noch ein angemessenes, wenn auch nur symbolisches Grab gefunden, wodurch nach Ansicht der alten Ägypter ihr glanzvolles Weiterleben im Jenseits jedoch gesichert war, da sie wie die Gottheit Osiris abgebildet sind. Ironie der Geschichte: Genau diese wichtigen Osiris-Abbildungen an den Särgen derjenigen drei Könige, die der durch die Amun-Anhänger verfemten Aton-Religion angehörten, blieben erhalten und sicherten ihnen somit – als einzige der zahlreichen Pharaonen – ein glanzvolles Leben „in alle Ewigkeit“, jedenfalls nach Auffassung der alten Ägypter.
Die kostbare Totenmaske auf der Mumie ist vielleicht das bekannteste Grabstück von Tut-ench-Amun. Sie zeigt ein eindrucksvolles, doch knabenhaftes Antlitz. Sie stellt den König zu Lebzeiten dar. Zwischen den Binden der Mumie fand man 143 wertvolle Amulette und Schmuckstücke – teilweise von einzigartiger Schönheit. Eine Mumienuntersuchung zeigte aufgrund der Kopfform, der Knochenmerkmale und einer DNA-Analyse, dass der Knaben-König in ganz enger Verwandtschaft zu dem König im Grab KV 55 gestanden haben muss. Kein Wunder: Es war sein Vater, der dort bestattet worden war!
Zwar war dem Knaben-König nur ein kurzes, relativ unbedeutendes Leben vergönnt – aber als bestatteter Pharao hat er einmaligen Weltruhm erlangt. Seine eigentliche Bedeutung und sein Vermächtnis treten erst jetzt zutage: Er hält bis auf den heutigen Tag die Erinnerung an die herausragende, lichtvolle Amarna-Zeit unter Ech-en-Aton und Nofretete durch seine Grabausstattung weiter lebendig. Wie dem Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ (5) zu entnehmen ist, wurde immer wieder in der Vor- und Frühzeit versucht, den Menschen den wahren Gottglauben durch Auserwählte zu vermitteln. Zu diesen gehörten offensichtlich auch Ech-en-Aton und Nofretete, und der junge Tut-ench-Amun bzw. Tut-ench-Aton sollte eigentlich die Nachfolge antreten.
Literatur/Quellen:
o. Vf., Verwehte Zeit erwacht, Verlag der Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart 1990 (1)
Christian Jacq, Nofretete und Echnaton, Rowohlt Verlag, Reinbek 2000 (2)
Joyce Tyldesley, Ägyptens Sonnenkönigin, Limes Verlag, München 2000 (3)
Читать дальше