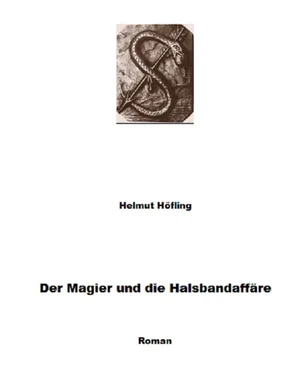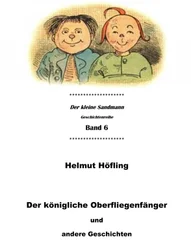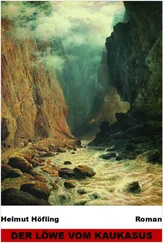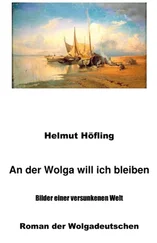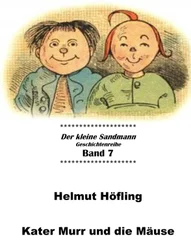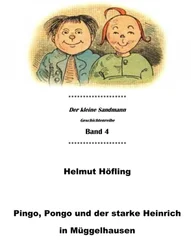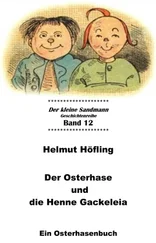Der große Magier verstand es ausgezeichnet, den Trennungsschmerz von seinen so liebgewonnenen Schülern zu heucheln, und verhieß jedem, ihn in einen Wirkungskreis zu bringen, durch den seine Fähigkeiten zum Wohl der Menschheit und der Welt ausgebildet werden sollten. Auch Schätze dieser Erde, Gesundheit und ein langes Leben versprach er einigen von ihnen. Sie alle aber forderte er in einer weitschweifigen Rede erneut auf, den Schöpfer aller Dinge in andächtigen Gebeten anzuflehen, ihn sein angefangenes Werk gut vollenden und zu immer höherer Vollkommenheit aufsteigen zu lassen.
Er wirkte wie abgehoben, als er an der Seite seiner Serafina das Haus verließ und in die bereitstehende Kutsche stieg, und so mancher verklärte Blick verfolgte ihn, wie er davonfuhr.
Da zieht er hin, der edle Ritter, und nimmer kehrt er wieder, hoffentlich! dachten Hinz und die anderen Widersacher spöttisch, es könnte ihm sonst vielleicht von neuem glücken, die guten Seelen für sich einzunehmen. Steter Tropfen höhlt den Stein. Wer weiß, wer noch alles empfänglich geworden wäre für höhere Weihen à la Cagliostro, hätte unser teurer Meister nicht soeben das Weite gesucht. Mit mehr Verstand, mehr Wissenschaft und feinerer Weltkenntnis hätte er sich bei uns in Kurland vielleicht noch eine Zeitlang halten können. Doch alle seine Geisterbeschwörungen, seine chemischen Experimente sind immer und überall dieselben. Wer ihn nur ein einziges Mal gehört und hantieren gesehen hat, musste stets das gleiche hören und sehen, er hat es nicht einmal verstanden, seinen Gaukeleien den Reiz der Neuheit zu geben oder einiges daran zu ändern, geschweige denn etwas zu erfinden, was er nicht vorher schon hundertmal gesagt und getan hat - bis auf die Namen, die er für sich und seine männermordende Messalina ersonnen hat. Federico Gualdo hat er sich ja auch hier mal genannt, ohne zu wissen, was wir wissen, dass dies nämlich der Verfasser des Buches ist, aus dem er genommen hat, was ihm in den Kram passt. Aber dass er sich auch noch, wenn er gerade in höchsten Himmelssphären schwebte, mal für Elias, mal für den Conte de Saint-Germain, ja sogar für den König Salomon ausgegeben hat und Madame Serafina, die angeblich hochwohlgeborene Principessa di Santa Croce, für die Königin von Saba - das sichert ihm für alle Zeiten den Lorbeerkranz des großen Dichters und Erfinders. Wenn erst einmal Gras über das Intermezzo in Mitau gewachsen ist, dann dürften sich wohl alle in ihrem Urteil über Cagliostro einig sein: Er war in der Tat ein Mensch, der leicht und bald zu durchschauen war, hätte man ihm nicht selbst immer wieder bis zum Schluss die Stange gehalten: sei es aus einem Vorurteil heraus oder einem Hang zur Mystik, sei es aus Furcht vor seinen abstoßenden Grobheiten und dem Widerwillen seiner treuen Anhänger - und nicht zuletzt auch aus Scham, wie es ja bei den meisten der Fall war.
Eine rühmliche Ausnahme in dieser Beziehung bildete der Herzog von Kurland, der sich nicht gescheut hatte, über Cagliostros Zeichenkünste die Dinge beim Namen zu nennen, als der Magier ihm vorgab, mit Hilfe der Geister in wenigen Minuten eine Tuschzeichnung anfertigen zu können, für die selbst der geschickteste Maler mehrere Tage brauchen würde. In Wirklichkeit aber benutzte er dazu eine Walze in der Art einer englischen Kopiermaschine, die er, vor neugierigen Blicken geschützt, in seinem Koffer verschlossen hielt. Damit konnte er einen fertigen Kupferstich, nachdem er ihn ebenso befeuchtet hatte wie das Papier, worauf er ihn abnehmen wollte, in kurzer Zeit abdrucken. Um den Kunstgriff zu verbergen, überpinselte er nachher den Abdruck mit schwarzer Tusche und brachte noch etwas stärkere Schwärze in den Schatten des Risses ein, als sei es die sogenannte lavierte Zeichnung. Der Schwindel flog jedoch auf, als er dem Herzog von Kurland den Abdruck einer englischen Landschaft schenkte, wovon dieser den Originalkupferstich selbst besaß und sogleich in Cagliostros „Werk von eigener Hand“ wiedererkannte. Als der Herzog beide Blätter verglich, fand er in der Kopie alles seitenverkehrt dargestellt.
Der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht, dachte so mancher Spötter. Vielleicht aber brach er noch lange nicht. Wer wusste schon, wie die Russen sich von seinem Hokuspokus blenden ließen.
Das Verbot des Magiers, niemand dürfe sich seines davongejagten Dieners, „dieses nichtswürdigen Menschen“, annehmen, hatte keinen Bestand; denn natürlich hielt sich niemand an diese Weisung, und sobald Cagliostro ihnen und ihrer Stadt den Rücken gekehrt hatte, trat der Bursche in die Dienste eines kurländischen Gutsherren. Ferber, der bald darauf mit dem Diener ins Gespräch kam, vertraute er ausführlich an, wie Cagliostro die ganze Gesellschaft zum Narren gehalten hatte. Sie seien nicht die ersten und würden auch nicht die letzten sein. Er war schon in seinen Diensten, als der gerissene Gauner in Venedig, damals unter anderem Namen, einen Bankier um mehr als zweitausend Zechinen betrogen hatte, und zwar allein dadurch, dass er in ihm die Hoffnung geweckt hatte, Quecksilber in Silber verwandeln zu wollen, worauf der geprellte Bankier wohl bis zum Nimmerleinstag vergebens warten werde. Denn mit diesem hübschen Sümmchen im Sack hatte sich der Halunke dann still und heimlich auf die Socken gemacht, wie das so seine Art war.
Über die schändliche Behandlung jüngst in Mitau war der Diener noch immer so aufgebracht, dass er seinem Feind am liebsten nach Petersburg nachgereist wäre, um die Russen vor den gleichen Schwindeleien zu bewahren. Doch gelang es Ferber, ihn von diesem Rachefeldzug abzuhalten, weniger aus Rücksicht um Cagliostro als vielmehr aus Sorge um die Ehre der Mitauer Gesellschaft, die dem Betrüger so leichtgläubig auf den Leim gegangen war und ihn deshalb auch aus Scham um Verschwiegenheit bat.
7
Auch Hofrat Schwander atmete auf, als Cagliostro endlich Kurland verlassen hatte und Elisa in Mitau geblieben war. Sie könne wirklich von Glück reden, dass sie jetzt nicht auf dem Weg nach Sankt Petersburg sei, zusammen mit diesem Scharlatan, sagte er ihr, als sie ihn besuchte. Es kam wie immer, wenn es um Magie und Cagliostro ging: Beredt und klug widersprach Schwander der Wirklichkeit der Magie und verdammte alle Wundertaten als Taschenspielereien eines Jahrmarktgauklers, worauf sie ihm aus ihrem „zusammengeknüpften Spinnengewebe magischer Systeme“, wie er es spöttisch nannte, so viele Gegengründe vorbrachte, dass er schließlich seufzte, sie zu bekehren, sei ein noch härteres Stück Arbeit als die Bekehrung Rechas durch Nathan den Weisen. Trotzdem versuchte er ihr wenigstens klarzumachen, dass sie über ihr Streben nach höheren Kräften die Pflichten gegen ihre Mitmenschen vernachlässige, worauf sie ihm wieder aus ihrem magischen System heraus zu beweisen glaubte, dass man überhaupt nicht auf dem rechten Weg der Magie sei, solange man nicht seinen persönlichen Einsatz für diese Welt mit dem Streben nach höheren Kräften verbinde.
Nun ging Schwander dazu über, ihren Hang zur Mystik ins Lächerliche zu ziehen: Nach Cagliostros Lehren komme ihm die ganze Schöpfung wie eine Zauberlaterne vor, und der Schöpfer solch einer Welt stehe weit unter dem Gott, wie er ihn sich vorstelle. Am Ende sei er gar selbst noch ehrwürdiger als der Gott, der so weit unter dem Ideal stehe, das er sich vom Weltschöpfer gemacht habe. Wahre Fratzenwesen seien auch die Geister, die Cagliostro unterständen. Sobald er mit ihnen Verbindung aufnehme, mache er sie rebellisch. Sie sollten sich besser nicht mehr unter die Fußsohlen ihres Herrn und Meisters schmiegen und sich vor seinem magischen Schwert fürchten.
Solche Spötteleien festigten Elisas Glauben an Cagliostro noch mehr, und mit all ihrer Überzeugungskraft versuchte sie Schwander klarzumachen, dass er das magische System überhaupt nicht begriffen habe. Die Geister, die Cagliostro mit dem Degen und durch Stampfen mit den Füßen im Zaum halte, seien die mittleren bösen Geister, so behauptete sie und glaubte, damit etwas Rechtes bewiesen zu haben.
Читать дальше