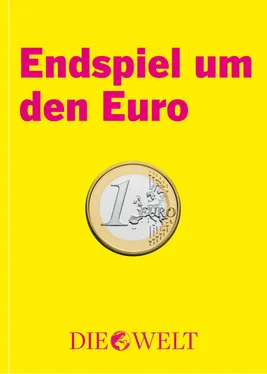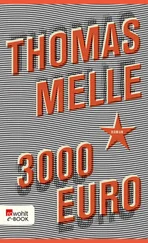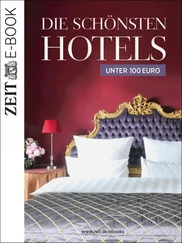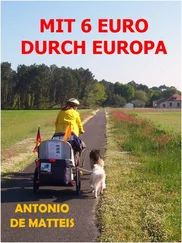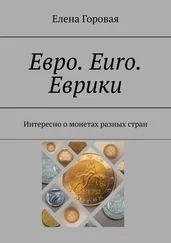Bei dem Masterplan handelt es sich um eine Euro-Agenda für die kommenden fünf bis zehn Jahre. Schon jetzt zeichnet sich aber ab, dass man dafür einen hohen Preis zahlen könnte: eine weitere Spaltung zwischen den 17 Euro-Ländern und den übrigen zehn, mit Kroatien ab dem kommenden Jahr elf EU-Staaten.
Schon als Merkel den Fiskalpakt durchdrückte, nahm sie in Kauf, dass sich mit Großbritannien und Tschechien zwei EU-Partner verweigerten. Diese Entwicklung dürfte sich mit dem Visionsbericht fortsetzen. Europa nimmt das Risiko der Spaltung in Kauf. "Wir müssen die Euro-Zone vertiefen, um sie zu stabilisieren", sagt einer der Vordenker. "Die Euro-Zone muss eine Vorreiterrolle spielen", fügt ein anderer hinzu. Lediglich Kommissionspräsident Barroso dringt noch darauf, eine Architektur für alle 27 EU-Staaten zu entwerfen, nicht nur für die Währungsunion.
In Berlin, in Frankfurt und Luxemburg hält man zwei Geschwindigkeiten für möglich: Was immer geht, soll mit allen Ländern in Angriff genommen werden, alles andere nur mit den 17 Euro-Staaten. Das ist ein Strategiewechsel für die europäische Einigung. "Aber dieser Strategiewechsel muss kommen", sagt ein Zentralbanker. "Das gemeinsame Geld ist Europas prägendes Element." Das gilt für die Krise wie auch für den Versuch, ihr zu entkommen. Florian Eder; Sebastian Jost; Jan Hildebrand; Anja Ettel
Bankenunion, neue Institutionen, gemeinsame Politik, Reformen: Das sind die Elemente des Masterplans. Wie realistisch sind sie?
Bankenunion
Die konkretesten Pläne gibt es bislang für das Zusammenwachsen des Bankenmarktes. Sowohl die Europäische Zentralbank als auch die EU-Kommission machen sich dafür stark.
Die Bankenunion soll drei Elemente umfassen: eine europäische Bankenaufsicht, eine gemeinsame Einlagensicherung und einen zentralen Rettungsfonds für Not leidende Institute. Vor allem Letzteres wäre eine unmittelbare Antwort auf eines der größten Probleme der Euro-Krise: Geraten große Banken in Schieflage, werden sie schnell zur Existenzbedrohung für ihr Heimatland.
Dieses Dilemma trieb bereits Irland unter den Rettungsschirm und bedroht nun Spanien. Auch Einlagensicherungssysteme haben sich nur als vertrauenswürdig erwiesen, wenn ein zahlungskräftiger Staat dahinter steht - deshalb käme es Krisenländern entgegen, wenn auch die Einlagensicherungen zusammengelegt würden. Im Gegenzug dürften dann freilich auch nicht länger nur nationale Aufseher über ihre Banken wachen.
Dass sich multinationale Banken nicht national bändigen lassen, ist weitgehend Konsens. Doch im Detail hagelt es Kritik. Sie kommt vor allem aus Ländern, deren Banken gut durch die Krise gekommen sind oder aber bereits mit eigenen Steuergeldern stabilisiert wurden.
So lehnen die deutschen Branchenverbände eine gemeinsame Einlagensicherung ab, weil diese "zu einer Vergemeinschaftung von Risiken insbesondere zu Lasten der deutschen Kreditinstitute" führe. Ähnliche Vorbehalte gibt es gegenüber einem europäischen Rettungsfonds. "Gerade in Deutschland kann man diese Idee nur verkaufen, wenn dieser Fonds von der Finanzbranche selbst finanziert wird, etwa über eine Bankenabgabe oder eine Transaktionssteuer", heißt es in EZB-Kreisen.
Nur: Ein solcher Fonds bräuchte viele Jahre, bis er handlungsfähig wäre. Kurzfristige Hilfe gäbe es nur mit Steuergeldern - was eine Art Fiskalunion durch die Hintertür bedeuten würde.
Fazit: Die Idee, dass zu einer Währungsunion auch ein stärker integrierter Bankenmarkt gehört, ist unstrittig. Doch weil die Banken einzelner Länder unterschiedlich gut dastehen, droht einiges an Streit darüber, wer wie viel in die Rettungsfonds einzahlt. Selbst wenn man sich einigt: Das Thema Bankenunion eignet sich kaum, um die Bürger wieder emotional für Europa zu begeistern.
Strukturreformen
Eine Vertiefung der europäischen Integration sei unerlässlich, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel Anfang Juni 2012 - und mahnte damit zunächst vor allem eines an: Strukturreformen.
Es ist das deutsche Credo seit Anbeginn der Krise: Die Staaten in Südeuropa müssten ihre Sozialsysteme erneuern, ihre Arbeitsmärkte deregulieren, den Binnenmarkt vollständig Realität werden lassen.
Das versprechen die Krisenländer seit geraumer Zeit. Allein: Es geht nicht überall gleich schnell voran. Die EU-Kommission stellte Defizite bei den Bemühungen erst dieser Tage für Spanien fest und für Griechenland sowieso.
"Das wahrscheinliche Ergebnis der aktuellen Reformbemühungen wird sein: Wir Deutsche bekommen die politischen Reformen, die wir haben wollen, und öffnen dafür unser Portemonnaie noch ein Stück weiter", sagt Jürgen Neyer, Professor für Politikwissenschaft an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder. "Klassisch hegemoniale Politik" nennt er das: Die Deutschen wollen die Reformen, über deren Notwendigkeit sich Politik und Ökonomie einig sind, erzwingen.
Andersherum: Frankreich, Italien, Spanien wollen erst deutsches Geld sehen, bevor sie sich auf harte Reformen einlassen. "Eine Alternative hierzu scheint es derzeit allerdings nicht zu geben, da kein anderer Staat in Europa in der Lage ist, die notwendigen Ressourcen für eine effektive Krisenbewältigung zur Verfügung zu stellen", sagt Neyer.
Fazit: Eine Einigung auf eine gemeinsame Reformpolitik kann schnell gehen. Im Grundsatz sind die europäischen Regierungschefs einverstanden, sie haben sich auch mehrfach in die Hand versprochen, nicht zulasten künftiger Generationen zu wirtschaften. Aber wie so oft: Es hapert an der Umsetzung.
Fiskalunion
Dieses Ziel definiert jeder, wie es ihm gefällt. Die Bundesregierung verweist sofort auf den Fiskalpakt, den Angela Merkel in Europa durchgesetzt hat und der gerade in den einzelnen Staaten ratifiziert wird. In dem Vertrag verpflichten sich alle EU-Staaten - mit Ausnahme von Großbritannien und Tschechien - auf strenge Haushaltsziele. Sie geben sich also einen gemeinsamen Rahmen für ihre Finanzpolitik. Auf diesem Weg könne man gern weitergehen, heißt es in Berlin.
Schon bei den Verhandlungen zum Fiskalpakt wollte die Kanzlerin eigentlich noch schärfere Regeln durchsetzen. So sollte die EU-Kommission Schuldensünder vor den Europäischen Gerichtshof zitieren können. Das ging dann vielen Staaten, vor allem Frankreich, doch zu weit.
Die Südeuropäer denken bei Fiskalunion hingegen nicht zuerst an gemeinsame Haushaltsregeln, sondern an gemeinsame Schulden, an Euro-Bonds, für die gemeinschaftlich gehaftet werden würde. Für die Krisenländer würden die Zinsen sinken, für Deutschland würden sie steigen.
Merkel lehnt die Euro-Anleihen nicht zuletzt deshalb ab, da sie befürchtet, dass dann der Schuldenschlendrian wieder Einzug erhält in Europa. Allerdings wird die Absage stets mit einem "derzeit" versehen. Wenn es eine europäische Finanzpolitik mit Durchgriffsrechten in die nationalen Haushalte gibt, sind auch für die Bundesregierung Euro-Bonds denkbar. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg.
Fazit: Viele Experten halten es für einen Konstruktionsfehler der Währungsunion, dass die Euro-Staaten bis heute keine gemeinsame Finanzpolitik haben. Diesen zu beheben wird aber schwierig.
Dagegen stehen nicht nur die Bedenken, dass die Schuldenländer es sich auf Kosten der deutschen Bonität gut gehen lassen. Viele Länder sind nicht bereit, Haushaltsrechte abzutreten. Zudem wäre eine Änderung der EU-Verträge notwendig. Und die ist kompliziert und langwierig.
Politische Union
Das Demokratiedefizit in der EU wird häufig beklagt. Eine Stärkung des Europäischen Parlaments würde helfen, das Defizit verringern. Zudem hoffen die Architekten des neuen Europa darauf, dass die Bürger sich wieder mehr für Europa begeistern, wenn sie mehr Einfluss auf Brüssel bekommen.
Читать дальше