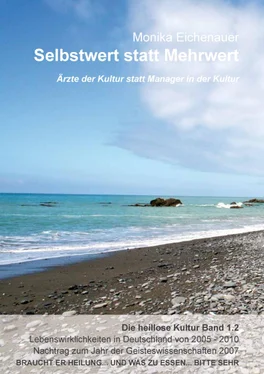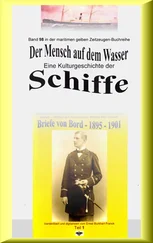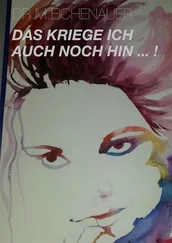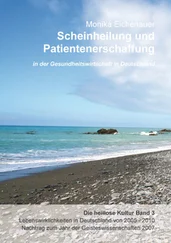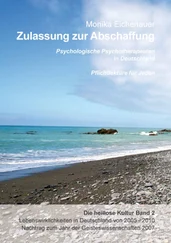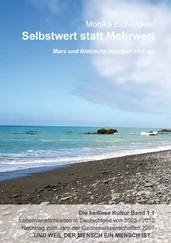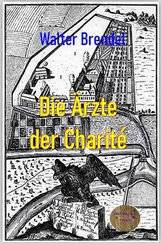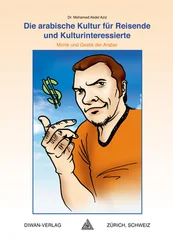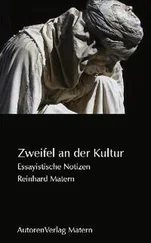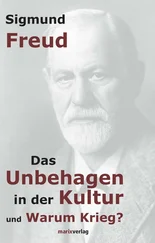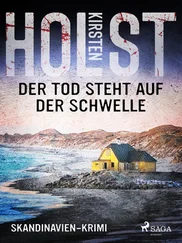1 ...7 8 9 11 12 13 ...39 Hier kommt das schöne Wort „Habgier“ ins Spiel. In der Gier verschmelzen die oberflächlich gegensätzlichen Inhalte von geizen und geilen miteinander, die ein normaler Bürger und Mensch erst mal nicht in Beziehung setzen würde, im „Bauch“ gefühlsmäßig zusammen: Und im Bauch des Bürgers findet sich logischerweise der durch die Globalisierung erzeugte Mangel. Ein Mangel wird jedoch auch assoziativ bei „Geiz“ und „Gier“ spruchreif: Und wer einen Mangel hat, möchte ihn beseitigen. Wenn man Durst hat, möchte man trinken. Dito: Mangel erinnert und provoziert das Gegenteil, nämlich das Bedürfnis, etwas haben zu wollen, und schon wendet sich das im Bauch erzeugte Gemisch von Geiz und Gier dann folgerichtig wiederum nach Außen – die Gier ändert nach der Ist-Soll-Prüfung im Bauch des Menschen die Richtung und hält Ausschau nach Befriedigung des Mangels.
Der Mensch, der diesen Spruch liest oder hört, fühlt sich zweifach entlastet: Er fühlt sich verstanden – insbesondere vor dem Hintergrund der Euro-Umstellung und Arbeitslosigkeit, die zusätzlich von vielfältigen steuerlichen und preislichen Erhöhungen begleitet wurden und werden. Weiter fühlt er sich bestätigt, nämlich auf diese wirtschaftliche Entwicklung mit „Geiz“ zu reagieren. Geiz wird nicht länger als Negativ und drum’ zu vermeidendes Verhalten deklariert, sondern als nicht nur positiv, sondern gesteigert zu „geil“, auch noch geradezu als legitimiertes und lustvolles Erleben! Ist-Soll-Prüfung soll bedeuten: Ich habe eigentlich nichts im Portemonnaie, nur noch ein wenig und ich sollte besser aufpassen, was ich mit meinem Geld und meinem Bedürfnis, doch etwas haben zu wollen, anfange: Also schaue ich doch, dass ich für möglichst wenig Geld (Geiz) maximal viel (geil) Befriedigung meines Bedürfnisses bekomme. Und schon geilen und gieren Menschen und kaufen ein! Statt zu sparen.
Das ist perfekt! Vielleicht kennen Sie das: Sie haben Gäste und die Befürchtung, es könnte zu wenig von allem da sein! Was sagen Sie? Ich habe gelernt zu sagen: „Kinder, greift zu, es ist genügend da!“ Und bislang gab es niemals die peinliche Situation, dass jemand feststellen musste: Das stimmt ja gar nicht! Wenn Sie aber sagen: „Oh, das ist jetzt die letzte Schale Reis …“, dann wird urplötzlich jeder sooooo einen Appetit auf Reis entwickeln, und alle befürchten, zu wenig abzubekommen.
Das heißt: Wenn Menschen den Eindruck des Mangels haben, setzt die Gier ein und gibt keine Ruhe, bis sie eines hat: Befriedigung – also nicht anders als bei Geilheit und Geiz!
Die botanischen Wurzeln der beiden Worte muss ich Ihnen noch kurz mitteilen, weil sie so schön anschaulich sind:
„Das in älterer Zeit fachsprachlich im Gartenbau übliche Geiz Nebensprößling’ (Anfang 18. Jh.), dafür heute Geiztrieb, geht von der Vorstellung aus, daß dieser den Pflanzen gierig den Saft aussauge.“ Und: „(…) geil(e) ‚Üppigkeit (8. Jh.), Fröhlichkeit, auch ‚Hoden’. Geil‚ fruchtbar, üppig wachsend, wuchernd, von Tieren und Pflanzen (15. Jh.) ist vom 19. Jh. an selten.“ (Etymologisches Wörterbuch, 1995, S. 414 und 416)
Dieser Nebensprössling Geiz aus dem 18. Jahrhundert avanciert in Gemeinschaft mit dem Wort geil , dessen Bedeutung sich zehn Jahrhunderte lang vor allem in den Fahrwassern von „Üppigkeit, Fröhlichkeit“ bewegte, wird erst in neuer Zeit mit „sich sexuell erregen“ assoziiert. Eine Assoziation, die von den kapitalistisch-globalistischen Stromschnellen der vampiristischen Wettbewerbsideologie gerne mitgerissen wurde. Denn wenn auch nur der leiseste Verdacht besteht, beim Bürger sei noch etwas zu holen, dann wird der Ökonomist dieser Fährte instinktiv nachgehen – und auch der Bürger folgt seinem Instinkt, angesprochen von diesem Slogan, obgleich er nichts in der Tasche hat.
Im Übrigen haben da die Politiker von den Ökonomisten, sieht man sich die Steuergesetzgebung an, gelernt: Nur holen sie sich das Geld bei den Armen statt bei den Reichen! Aber dieser Spruch „Geiz ist geil“ ist ja auch nicht für die Reichen. Es ist ein typischer Spruch für Unten, so, wie man sich die Menschen Unten so vorstellt, dass sie funktionieren sollen: Sex sells.
Der kapitalistische Wettbewerb müsste diesen Slogan mit einem Siegerpreis krönen ob der Perfektion und Chuzpe, mit der er Menschen dazu bekommt, doch noch die Tische leer zu kaufen, selbst wenn sie kein Geld dafür haben. Wofür gibt es schließlich Kreditanstalten! Wie man weiß, sind inzwischen viele Bürger nicht unerheblich verschuldet. Das liegt selbstverständlich nicht nur an diesem Werbeslogan, sondern an der generellen Halbierung des Einkommens durch die Euroumstellung und die vielen zusätzlichen steuerlichen Abgaben und (Verkehrs-) Kontrollen – und durch Arbeitslosigkeit.
Geilen und Geizen verbindet also in der Tiefe das Gieren: Eine explosive Mischung, die negative Eigenschaften ins Positive verkehrt und zusätzlich mit sexueller Kraft potenziert. Sozusagen eine ökonomistische Alchemie, aus Dreck Kunst oder besser Gold werden zu lassen: Kleinvieh macht auch Mist. Damit schafft der Slogan eine neue Werteordnung, wie sie auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene der Politik und Ökonomie erwünscht ist: Konzentriert und maskiert streift er die Bedeutung politisch-ökonomischer Umwälzungen auf der negativen und die „Schuld“ verkehrenden Resultatebene : Geiz. Auf der Handlungsebene hingegen wird zu einem verkehrenden Verhalten aufgefordert: Der Bürger soll keineswegs „nichts“ kaufen, sondern er soll preiswert einkaufen, er soll ebenfalls zum Vampir werden, der aufgrund und wegen seines Mangels kauft. Diese Verbindung − weniger haben, aber dennoch kaufen − harmonierte haargenau mit den Hoffnungen von Politik und der Ökonomie: Der Binnenmarkt drohte vollständig abzusacken. Die Bürger waren angesichts der Euroumstellung sehr schlecht gestimmt, und so wurde schlagartig weniger gekauft. Die Werbebranche musste sich etwas einfallen lassen.
Das Ergebnis: Die Scham über die negativen finanziellen Veränderungen in den einzelnen Haushalten der Bürger wurde schlagartig abgeschafft, und die der Verarmung zugrunde liegende Realität des finanziellen Mangels öffentlich thematisiert.
Das „Zuwenig“ „alchemisierte“ man in eine aktive Bürgerhandlung, nämlich Geiz. Damit fand eine Angleichung mit den Besitzenden statt – denn Gier und Geiz ist ihnen als Wesensmerkmal mit in die Wiege gelegt: Natürlich nicht sich selbst gegenüber, sondern generell den Besitzlosen gegenüber. Natürlich wurden die Menschen nicht plötzlich geizig; sie mussten schließlich mit fünfzig Prozent weniger Kaufkraft zurechtkommen. Das Opfer, das aufgrund der Euroumstellung spürbar weniger im Portemonnaie, einen Arbeitsplatzverlust zu ertragen und somit eine komplette Neujustierung seines Lebenswandels auf eine festgelegte Quadratmeterzahl vorzunehmen hat, dieses Opfer der Globalisierung wird nun zum „Täter“: Er, der Arme und Verarmende, ist derjenige, der geizig ist oder es sich gestatten soll, geizig zu sein! Er soll sich nicht mehr schämen, die Preise zu vergleichen – nein, er soll ins Rampenlicht mit seiner Gier, etwas haben zu wollen! Er ist der Vampir, der den Hals nicht voll genug bekommt, der bitteschön preisbewusst handeln und zum Unternehmen eilen soll, um sich die Vorteile zu sichern!
Er, der Bürger, soll sich nicht grämen über die Verluste, die er hinzunehmen hat, nein, er soll fröhlich und aktiv mit der Situation umgehen und als Sieger aus dieser wirtschaftlichen Misere herausmarschieren. Mach dir einfach die Geiz-Haltung zu Eigen – und schon geht es bergauf.
Der Spaßfaktor „geil“ garantierte zudem, dass diese Wendung finanzieller Anpassung in einigermaßen positive, statt in negative und depressive wie schamhaft-emotionale Fahrwasser gelenkt wurde. Der Wettbewerb, möglichst genau zu schauen, wie viel man wofür bezahlt, wurde favorisiert. Je billiger, desto besser – je geiziger und gieriger einer ist, der nichts im Portemonnaie hat, desto geiler! Eine Gegenkultur zum Je teurer, desto besser. Je exklusiver die Marke, desto mehr ist der Markenträger wert war geschaffen. Hiermit ist eine Alchemie angesprochen, die Gefühle und reale wirtschaftliche Verhältnisse in Einzelhaushalten sowie Handlungsmodi und Selbstwertgefühle manipulierten – pünktlich zum weiteren Grundausbau der Zweiklassengesellschaft. Denn damit war klar, welcher Wert für Unten favorisiert wird und welcher für Oben. Die Geld- und Auftraggeber der Werbe- und Medienagenturen lassen den heiligen Geist der kapitalistischen Ökonomie in tausend Zungen sprechen, um den Bestand der Wirtschaft und der Politik zu gewährleisten. Und so hätte der „Geiz ist geil“- Slogan auch von der Regierung als neue Orientierung herausgegeben werden können.
Читать дальше