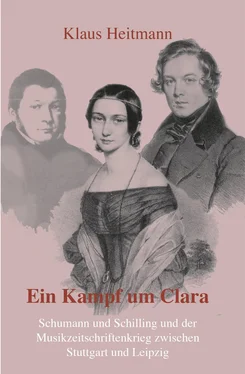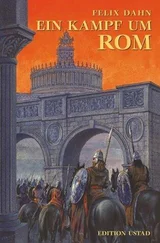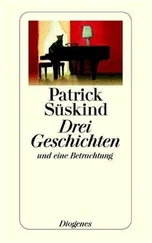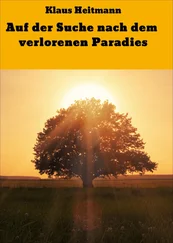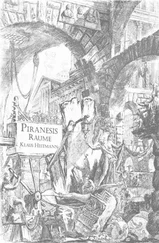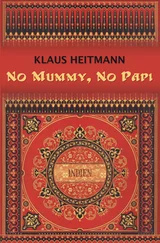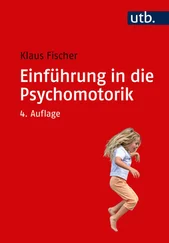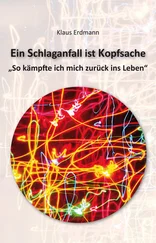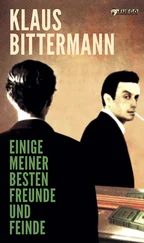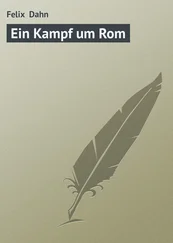Ein erstes Beispiel von Schillings Verhältnis zum Thema Bescheidenheit. Weiter heißt es:
„Sein Beruf hinderte ihn jedoch in seiner musikalischen Thätigkeit nicht. Jm Jahre 1830 begab er sich nach Stuttgart und gründete daselbst ein öffentliches musikalische Lehrinstitut; in demselben Jahre schrieb er auch ein kleines musikalisches Wörterbuch besonders für Clavierspieler bestimmt. Eine Frucht der Julirevolution war eine Schrift, welche er unter dem Titel „Was ist Schuld an den Gährungen der Zeit und wie kann denselben abgeholfen werden“ erscheinen ließ.“
In dieser Schrift, die er dem württembergischen König Wilhelm zu seinem Einstand in Stuttgart „in tiefster Untertänigkeit“ widmete, vertrat er – man ahnt es - einen deutlich antidemokratischen Standpunkt.
„Jm Jahre 1832“ so fährt der Selbstbiograph fort, schrieb er den didactischen Roman „Guido“, der von allen Seiten sehr gut aufgenommen wurde. 1833 vollendete er sein Werk über Kanzelberedtsamkeit - ein Werk mit einem Umfang von nicht weniger als 800 Seiten, der in etwa das Maß angibt, das Schilling in seinen Schriften mit Vorliebe anstrebte - ein Werk also, „das ungemein Glück machte und nebst einigen siegreichen Diskussionen in öffentlichen Blättern über das Improvisieren auf der Kanzel Schillings Namen unter die berühmteren der theologischen Literatur setzte“ - man fragt sich, wie solche Siege festzustellen sind; im Übrigen haben wir hier ein weiteres schönes Beispiel von Schillings Verhältnis zum Thema Bescheidenheit; weiter schreibt er:
„Das allgemeine musikalische Lexikon, das er mit einem Vereine von musikalischen Schriftstellern herausgab, ist das reichhaltigste Werk dieser Art und in mehre fremde Sprachen übersetzt worden.“
Dieses sechsbändige Werk, das 1834 bis 1838 als „Universallexikon der Tonkunst“ herauskam, war tatsächlich nicht unbedeutend und ist auch heute noch von einigem Interesse, weil es einen ungewöhnlich guten Einblick in die Musikwelt der Zeit gibt, in der es entstand, was aber in erster Linie daran liegt, dass sein Verleger seriöse Mitarbeiter gewinnen konnte.
„1836 gab er“ so fährt er fort , „sein Unterrichtsinstitut auf; in der Folge erschien weiter von ihm ein Werk über „Aestethik der Tonkunst, eine Harmonielehre, Polyphonomos“; Lehrbuch der allgemeinen Musikwissenschaft; Generalbaßlehre; Geschichte der neuern Musik…“ - alles weitschweifige Werke, die bemüht sind, den oben bezeichneten Musterumfang einzuhalten - „und mehre kleinere Arbeiten.
In der neuesten Zeit hat sich auf seine Veranlassung und seine Bemühung ein „Deutscher Nationalverein für Musik und ihre Wissenschaft“ gebildet, dessen permanenter Sekretär er ist, und der bereits die ausgezeichnetsten Namen von Musikern und Gelehrten zu seinen Mitgliedern zählt. Dieser Verein giebt unter der Redaktion des Gründers eine eigene Zeitung heraus: „Jahrbücher des deutschen Nationalvereins für Musik und ihre Wissenschaft“, die wöchentlich einmal erscheint, und bereits zum gelesensten und werthvollsten musikalischen Journale sich aufgeschwungen hat“ - eine Behauptung, die Schumann, der seit 1834 in Leipzig das Konkurrenzblatt „Neue Zeitschrift für Musik“ herausgab, nicht unwidersprochen sein lassen konnte.
In seiner Selbstdarstellung verschweigt er ein weiteres, zu Anfang seiner Stuttgarter Zeit verfasstes Werk mit dem Titel: "Aestetische Beleuchtung des königlichen Hoftheaters in Stuttgart, in dem er seinen Gedanken über die Schauspielkunst ziemlich freien Lauf lässt. Vielleicht unterschlug er dieses Opus, mit dem er die Stuttgarter Theaterszene zu erobern gedachte, weil in diesem Fall die Behauptung, "es sei von allen Seiten gut aufgenommen worden", selbst für einen Schilling zu dreist gewesen wäre. Der Stil dieses "zeitgemäßen Wortes an alle Theaterdirektoren, alle Künstler und das gesamte kunstliebende Publikum" hatte nämlich den Direktor des Stuttgarter Katharinenstifts und "quiescierenden Theater-Recen-senten" August Zoller auf den Plan gebracht. Wie sehr Zoller - selbst ein begeisterter Schriftsteller - sich über Schilling aufregte, zeigt die Tatsache, dass er postwendend eine nicht weniger als 60-seitige Schrift unter dem Titel "Aesthetische Beleuchtung der nichtaesthetischen Verdunklung der Stuttgarter Hofbühne" verfasste, in der er die Phrasendrescherei und Altklugheit des damals 27-jährigen Schilling gnadenlos offen legte. Unter anderem verwahrte sich der Schulmann dagegen, dass dieser "Norddeutsche" sich herablasse, „uns blödsinnigen Schwaben die Augen zu öffnen". Bemerkenswert ist, dass diese überdeutliche Kritik nicht anders als die spätere durch Schumann bei Schilling und seiner Umgebung ohne jede Wirkung blieb.
Schilling schrieb, wie gesagt, über alles, was unter seine Feder kam. Seine außerordentliche Produktivität beruht aber weitgehend darauf, dass er in immer neuen Variationen bei anderen oder sich selbst abschrieb. Unter anderem plünderte er mehrfach das 6-bändige "Universallexikon der Tonkunst", das der Stuttgarter Buchhändler Köhler herausgegeben hatte. Auch der Vorwurf des Plagiats, der von mehreren Seiten, u.a. in der von Schumann redigierten "Neuen Zeitschrift für Musik" erhoben wurde, hinderte ihn nicht daran, abschreibenderweise ständig neue Bücher auf den Markt zu werfen. Allein von 1839 bis 1850 verfasste er auf diese Weise nicht weniger als einundzwanzig mehr oder weniger dickleibige Bücher über Musik und Musiker, was selbst wenn man berücksichtigt, dass er abschrieb, eine bemerkenswerte Fleißleistung war. Erstaunlich ist vor allem, dass es ihm gelang, immer wieder neue Verleger zu finden, obwohl sich die von ihm düpierten Vertragspartner in drastischer Weise öffentlich über ihn beschwerten.
Der durchaus vorhandene Erfolg des Vielschreibers beruhte wohl nicht zuletzt darauf, dass seine wichtigsten Vermarktungsinstrumente, Posten, Orden und Ehren, zugleich auch seine Waffen gegen die Plagiatsvorwürfe waren. Hinzu kam der gute Draht zu den Mächtigen. Seine Werke widmete er mit Vorliebe den lokalen Fürsten. Demonstrativ trug er Orden der Könige von Preußen und Belgien und verschiedene Verdienstmedaillen vor sich her. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung mit Schumann wurde er zum Hofrat von Hohenzollern-Hechingen ernannt.
Schillings "Deutscher Nationalverein für Musik und ihre Wissenschaft", für den er den schwer angreifbaren Wahlspruch „Omnia ad majorem Dei gloriam“ ausgewählt hatte, war eine konservativ ausgerichtete Vereinigung von Musikern und Musikpublizisten, deren Aushängeschild der hoch geachtete Komponist und Geiger Louis Spohr war. Auch diese Gründung – sie erfolgte im Jahre 1839 - diente der Befriedigung von Schillings Schreibwut. Die Artikel der „Jahrbücher“, welche der Verein herausgab, stammten im Wesentlichen aus seiner Feder. Alle Mitglieder, zu denen ohne sein Wissen auch Schumann gemacht worden war, mussten - gegen Entgelt, wie sich versteht - die "Jahrbücher" beziehen.
Diese Zeitschrift war der Punkt an der sich der Streit mit Schumann entzündete. Schilling beabsichtigte, Schumann zu seinem "Kompagnon" zu machen, ausgerechnet den Mann also, der nicht nur als Komponist die neuromantische Schule vertrat, die Schilling und der Nationalverein massiv bekämpften, sondern der als verantwortlicher Redakteur der „Neuen Zeitschrift für Musik“ auch noch deren literarisches Haupt und Schillings Konkurrent auf dem Zeitschriftenmarkt war. Eine besondere Brisanz erhielt der kühne Vorstoß dadurch, dass er Clara Wieck zu seinem Werkzeug erkoren hatte. Die ahnungslose junge Frau, in die er sich zu allem Überfluss auch noch verliebt hatte, wurde damit unbewusst zur Überbringerin des Fehdehandschuhs gegen ihren Verlobten. 1
Читать дальше