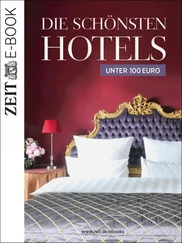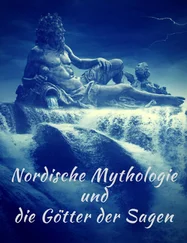Die Nacht brach herein. Der Vollmond stand am Himmel. Da warfen alle Steppenwölfe die Köpfe in den Nacken und heulten, nach dem Brauch ihrer Väter und Urväter, in allen Tonarten. Der Esel hatte nie in seinem Leben Wölfe gesehen und nie ihr Geheul gehört. Er blieb stehen, lauschte und sprach kennerhaft: »Das wollen Sänger sein! Mit meiner Stimme übertöne ich diesen jämmerlichen Chor.« Mit furchtbarem Pfeifen und Quietschen ließ er so viel Luft in die Lungen, wie es nur ging, und brüllte so laut, dass es in seinem eigenen Kopf dröhnte. Die Wölfe wurden vor Staunen sofort still: Woher kam mitten in der Nacht in der Steppe ein Esel? Wie auf ein Zeichen stürzten sie los und entdeckten sofort die Beute und damit endete die Geschichte des Esels.
Wenn ihr unbedingt noch eine Geschichte von Shaksybai hören möchtet, dann lauft, so schnell ihr könnt, in die alte Stadt Turkestan, sucht dort eilends den großen Basar und auf dem Basar die belebteste Teestube und tretet ohne Zögern ein. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Shaksybai, der seinen Esel vergessen hat, dort noch immer auf einer weichen Filzmatte sitzt, eine Schale Tee nach der anderen trinkt und allerlei glaubwürdige und unglaubwürdige Geschichten schwatzt. Der kann euch allerlei von sich selbst erzählen, ihr braucht nur zuzuhören.
Sarsembai wuchs als Waisenjunge auf. Er hatte weder Vater noch Mutter. Sein Leben war hart. Er verdingte sich bei einem reichen Bei als Schafhirte. Dafür versprach ihm der Bei im Herbst ein lahmes Schaf. Sogar darüber freute sich der Hirte. So hütete er die Herde, aß die Reste vom Tisch des Beis und wartete auf den Herbst. Wenn der Herbst kommt, erhalte ich das lahme Schaf und werde endlich wissen, wie ein Stück Fleisch schmeckt.
Eines Tages trieb Sarsembai die Schafe auf eine frische Weide. Da sprang auf einmal ein Wolf aus dem Busch und sprach: »Her mit einem Hammel! Tust du es nicht, zerreiße ich zehn von deinen Schafen.«
»Wie kann ich dir einen Hammel geben, die Herde gehört doch nicht mir. Der Bei erschlägt mich dafür.« Der Wolf überlegte eine Weile und sprach: »Ich bin sehr hungrig. Geh zum Bei und bitte bei ihm um einen Hammel für mich.«
Sarsembai ging zu seinem Herren und erzählte alles. Der Bei überlegte: Zehn sind mehr als einer; ein Hammel ist billiger als zehn. Zum Hirten sagte er: »Soll der Wolf einen Hammel haben. Aber er darf ihn nicht aussuchen. Verbinde ihm die Augen. Welchen er greift, der soll ihm gehören.«
Sarsembai tat, wie ihm geheißen. Der Wolf stürzte sich mit verbundenen Augen auf die Hammelherde und biss einem Schaf die Gurgel durch. Es gibt ein Sprichwort: »Ein Stock in der Steppe dringt dem Unglücklichen in die Stirn.« Es kam nämlich so, dass der Wolf jenes lahme Schaf zerriss, das der Herr Sarsembai versprochen hatte. Sarsembai weinte bitterlich. Der Wolf bekam Mitleid. »Nichts zu machen, Hirte«, sagte er. »Das Schicksal will es so. Ich lasse dir das Fell. Vielleicht verkaufst du es günstig.« Sarsembai warf sich das Schaffell über die Schulter und trieb die Herde weiter.
Da kam ihm der Bei auf dem roten Fuchs entgegen. Er stellte sich auf die Steigbügel und zählte die Schafe und die Hammel. Die Herde war vollzählig, nur fehlte das lahme Schaf Sarsembais. Da war auch schon Sarsembai in Sicht. Er lief hinter der Herde her, in der Hand den Hirtenstab, auf der Schulter das Schaffell, Tränen im Gesicht. Da lachte der Bei so laut, dass sogar das Pferd unter ihm zitterte. »Das ist mir ein schöner Hirte! Konnte sein eigenes Schaf nicht hüten. Und er wird auch auf meine nicht aufpassen... Fort aus meinen Augen! Wir sind quitt.«
Nun trottete Sarsembai durch die Steppe, immer dem Schatten seines Hirtenstabes nach. Er geriet in eine ferne Stadt und begab sich auf den Basar. Lange drückte er sich in dem Menschengewimmel herum, doch niemand fragte nach dem Preis des Schaffells. Erst gegen Abend verkaufte er es für drei kleine Münzen. »Für drei Münzen kann ich mir drei Brotfladen kaufen, von drei Brotfladen drei Tage leben. Komme, was da wolle!« Er lief zu den Brotläden, unterwegs begegnete ihm ein kranker Alter, der um ein Almosen bat. Sarsembai gab ihm eine Münze und behielt die zwei übrigen für sich. Der Alte nickte mit dem Kopf, bückte sich und hob eine Handvoll Sand auf, die er dem Jungen hinhielt. »Nimm das als Dank für deine Güte«, sagte er. Sarsembai glaubte, der Bettler hätte den Verstand verloren, wollte den alten Mann aber nicht kränken, nahm deshalb den Sand und schüttete ihn in die Tasche.
Die Nacht brach an. Es wurde dunkel. Wo sollte der heimatlose Hirte sich zur Ruhe legen? In einer Karawanserei bat er um ein Nachtlager. Der Besitzer ließ ihn ein, forderte aber Bezahlung, und Sarsembai gab ihm eine Münze. Alle anderen Mieter ließ der Wirt auf Teppichen und Filzmatten schlafen, nur Sarsembai musste sich auf den blanken Fußboden legen. Der hungrige Bursche schlief schlecht, auf dem kalten harten Boden hatte er schlimme Träume.
Am frühen Morgen wurde es laut in der Karawanserei, im Hof eilten Leute geschäftig hin und her. Fremde Kaufleute, die sich zum Weg rüsteten, bepackten die Kamele. Dabei unterhielten sie sich. Einer sagte: »Ich hatte in dieser Nacht einen wunderschönen Traum: Wie ein Khan lag ich auf einem prunkvollen Ruhebett, die helle Sonne neigte sich über mich, auf meiner Brust aber spielte der klare Mond...« Sarsembai trat an den Kaufmann heran und sprach: »Noch nie habe ich einen schönen Traum gehabt, Onkelchen, verkaufe mir deinen Traum! Es soll mein Traum sein.«
»Den Traum verkaufen?« fragte der Kaufmann spöttisch. »Was gibst du mir dafür?«
»Ich habe nur eine Münze - eine einzige.«
»Her damit!« rief der Kaufmann. »Die Sache ist abgemacht. Nun gehört der Traum dir, mein Junge.« Der Kaufmann lachte noch lauter, und alle anderen fielen in sein Lachen ein. Der Hirte aber, mit seinem Kauf sehr zufrieden, lief hopsend vom Hof.
Viele Wege ging Sarsembai, kam durch viele Aule, aber nirgends fand sich Arbeit für ihn, keiner reichte ihm eine Schale Airan. Es war Winter geworden. In dunkler Nacht irrte Sarsembai durch die Steppe und hauchte sich die Finger warm. Der böse Wind stieß ihn hin und her, der Wirbelsturm drehte ihn im Kreis. Sarsembai weinte und die Tränen froren ihm am Gesicht an. Kraftlos sank er in den Schnee und stammelte verzweifelt: »Weshalb diese Pein, hätten mich doch nur die Wölfe zerfleischt!« Kaum hatte er das gesagt, da stand ein riesiger Wolf vor ihm: das Fell gesträubt, die Augen runkelten! »Endlich Beute!« heulte der Wolf. »Da werden sich meine Kleinen freuen.«
»Töte mich, Wolf«, sagte der Junge still. »Sollen sich deine Kinder freuen. Der Tod ist für mich schöner als das Leben.« Der Wolf rührte sich aber nicht von der Stelle und schaute den Jungen unverwandt an. Endlich stieß er aus: »Bist du nicht Sarsembai, der mir das lahme Schaf gegeben hat? Guten Tag, ich habe dich erkannt. Fürchte dich nicht, ich tue dir nichts zuleide, ich will dir sogar dein Leben retten. Setze dich auf mich und halte dich fest!«
Sarsembai setzte sich auf den Wolf, und der trug ihn durch hohen Schnee bis zum Rand eines tiefen Waldes und sprach: »Siehst du das Lichtlein dort in der Feme? Dort brennt ein Lagerfeuer. Da haben Räuber Rast gemacht. Jetzt sind sie weiter geritten und kommen nicht so bald zurück. Gehe hin und wärme dich an dem Feuer. Am Morgen wird es vielleicht wärmer. Lebe wohl!«
Der Wolf verschwand, und Sarsembai eilte zum Feuer. Er wärmte sich und fand zur Stärkung ein paar Knochen, die die Räuber ins Feuer geworfen hatten.
Vor Glück hätte er am liebsten ein Lied angestimmt. Was braucht ein Armer mehr zum fröhlich sein?
Der Morgen graute, das Feuer brannte nieder und verlosch. Als das Holz verkohlt war, steckte der Junge die Hände in die warme Asche. Das war eine Wohltat! Er grub sie immer tiefer hinein und stieß plötzlich mit den Fingern an etwas Hartes.
Читать дальше