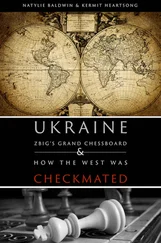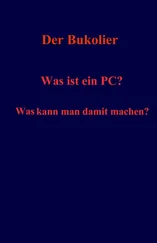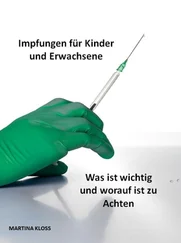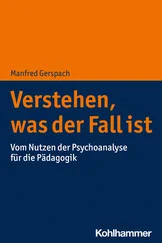Würde wenigstens ein großer Teil dieser Vorschläge umgesetzt, dann könnte Deutschland bis 2020 einen neuen Modernisierungsschub erleben. Die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft würde durch die Einbeziehung aller Arbeitskräftepotenziale, bezahlbare Energie, ein stabiles Finanzsystem und eine weitere europäische Integration gesichert. Unsere Sozialsysteme und Staatsfinanzen auf allen Ebenen blieben trotz der demografischen Herausforderungen nachhaltig solide. Doch dafür bedarf es – wie vor der Agenda 2010 – eines Rucks, der durch das Land geht. Ein Ruck, der uns diesmal nicht aus dem Selbstzweifel, sondern aus der Selbstzufriedenheit aufrüttelt. Der Selbstzufriedenheit, die sich dank der Erfolge der Agenda 2010, der Stärke der deutschen Industrie und der soliden Staatsfinanzen breitmacht.
Nun zeigt die historische Erfahrung, dass Reformen zwar theoretisch in guten Zeiten angepackt werden sollten, weil damit eventuell verbundene Zumutungen dann viel leichter zu ertragen sind, sie praktisch aber nur in schlechten Zeiten eine Chance haben, wenn der Leidensdruck die Mehrheitsbeschaffung erleichtert. Vielleicht schafft die Bundesregierung es dieses Mal ja, aus einer Position der Stärke heraus einen Reformschub einzuleiten. Zugegeben, der Koalitionsvertrag enthält dafür wenige Anzeichen. Aber gerade zu dieser Jahreszeit kann einem niemand das Wünschen verbieten. Wenn Sie so wollen, ist dies ein wirtschaftspolitischer Wunschzettel zu Weihnachten 2013.
Ich wünsche Ihnen nun eine ertragreiche Lektüre.
Ihr
Dirk Heilmann
Chefökonom des Handelsblatts und
Geschäftsführender Direktor des Handelsblatt Research Institute
ENERGIEPOLITIK
Prof. Dr. Justus Haucap, Gründungsdirektor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie (DICE) und Forschungsprofessor am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
Prof. Dr. Justus Haucap, geb. 1969 in Quakenbrück, ist Mitglied der Monopolkommission und Gründungsdirektor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie (DICE) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Er hat Volkswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes und der University of Michigan (Ann Arbor) studiert. Nach der Promotion an der Universität des Saarlandes (1997) und einem Aufenthalt als Gastforscher an der University of California (Berkeley) auf Einladung des späteren Nobelpreisträgers Oliver Williamson war Justus Haucap von 1997 bis 1999 war Haucap zudem als Senior Analyst für die New Zealand Treasury in Wellington tätig. Es folgten vier Jahre (1999-2003) als wissenschaftlicher Assistent am Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität der Bundeswehr in Hamburg, wo sich Justus Haucap 2003 habilitierte.Seit Juli 2006 ist Justus Haucap Mitglied der Monopolkommission, welche die Bundesregierung in Fragen der Wettbewerbspolitik und der Marktregulierung berät, von Juli 2008 bis Juli 2012 war er auch Vorsitzender der Monopolkommission.
Energiewende: Kraft der Wettbewerbskräfte nutzen!
Die ausufernden Kosten der Energiewende belasten Privathaushalte und Unternehmen und drohen Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland zu gefährden und damit letztlich auch die Akzeptanz des gesamten Projektes. Für viele Privathaushalte hat die Belastung durch steigende Energiekosten bereits jetzt eine kritische Größe erreicht. Sollten mehr Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland durch zu hohe Energiekosten nachhaltig gefährdet werden, kann die Energiewende nicht nur national scheitern, sondern auch als internationales Vorbild versagen.
Die Große Koalition hat diese Problematik zwar prinzipiell erkannt, scheint sich aber des Ausmaßes des Problems nicht hinreichend bewusst zu sein. Zu zaghaft und vorsichtig sind die im Koalitionsvertrag angelegten Reformen, die eher auf einige Detailverbesserungen abzielen als auf eine grundlegende Reform der Förderung der erneuerbaren Energien. Eine solche Reform ist jedoch dringend und schnell notwendig, um bezahlbare Energiepreise und Arbeitsplätze am Industriestandort Deutschland zu sichern. Anders gibt es weder die Akzeptanz der Energiewende in Deutschland noch einen internationalen Vorbildcharakter.
Die Energiewende ist eines der ambitioniertesten Projekte der deutschen Politik. Die Energieversorgung soll schon bald ohne Kernkraftwerke und langfristig möglichst auch ohne Kohle- und Gaskraftwerke durch eine möglichst dezentrale Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erfolgen. Bis spätestens 2020 sollen mindestens 35 % des Stroms durch erneuerbare Energien erzeugt werden, bis spätestens 2050 sollen sogar mindestens 80 % des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen kommen. Der Koalitionsvertrag hat nun weitere Zwischenziele für einen Ausbaukorridor der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien definiert: 40 bis 45 % im Jahr 2025, 55 bis 60 % im Jahr 2035.
Im Zentrum der öffentlichen Kritik stehen in jüngster Zeit zu Recht insbesondere die steigenden Strompreise und somit die Energiekosten insbesondere für private Haushalte. Seit dem Jahr 2000 sind die Strompreise für Privathaushalte kontinuierlich gestiegen, sie sind nominell nun mehr als doppelt so hoch wie 2000, Tendenz weiter steigend.
Eine ganz ähnliche Entwicklung wie die Preise haben, bei weitgehend stabilem Stromverbrauch, auch die Ausgaben der Letztverbraucher für Strom genommen. Ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt ist von 2000 bis 2011 von 1,7 % auf 2,5 % gestiegen, das entspricht somit einem Anstieg von etwa 50 %. Strom ist nicht nur absolut, sondern auch relativ, erheblich teurer geworden.
Für den Großteil der Industrie- und Gewerbekunden sieht die Preisentwicklung ganz ähnlich aus wie die der Haushaltskunden, wenn auch auf niedrigerem Niveau. Im internationalen Vergleich gehören die deutschen Strompreise inzwischen zu den höchsten in Europa. Nur Italien und Zypern haben nach jüngsten Angaben des VIK noch höhere Industriestrompreise als Deutschland. Auch in den USA und in den meisten asiatischen Staaten sind die Energiepreise deutlich niedriger als in Deutschland.
Ein ganz wesentlicher Treiber für die steigenden Strompreise ist die steigende EEG-Umlage, welche von 1,13 Cent/kWh im Jahr 2009 über 2,047 Cent/kWh (2010), 3,530 Cent/kWh (2011), 3,592 Cent/kWh (2012) und 5,277 Cent/kWh im Jahr 2013 nun auf 6,240 Cent/kWh in diesem Jahr angestiegen ist. Die Umlage hat sich in fünf Jahren somit mehr als verfünffacht, sie ist um etwa 450 % gestiegen.
Bei einer EEG-Umlage von 6,240 Cent/kWh zahlt eine vierköpfige Familie mit einem Verbrauch von 4000 kWh pro Jahr als Teil ihrer Stromrechnung etwa 250 Euro pro Jahr für die Förderung der erneuerbaren Energien (noch ohne Netzausbaukosten und Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung). Berücksichtigen wir jedoch, dass auch die EEG-Umlage-Kosten, die aktuell von Industrie, Handel und öffentlichem Sektor gezahlt werden, ultimativ doch von Verbrauchern durch höhere Preise oder von den Steuerzahlern (in dem Ausmaß, in dem öffentliche Einrichtungen von der EEG-Umlage betroffen sind) getragen werden, so ergibt sich bei einem prognostizierten Fördervolumen von etwa 23 Mrd. Euro für das Jahr 2014 eine Pro-Kopf-Belastung von über 280 Euro pro Jahr – für eine vierköpfige Familie sind das dann über 1100 Euro EEG-Zusatzkosten pro Jahr. Zum Vergleich: Die EEG-Förderung pro Jahr ist somit mehr als dreimal so hoch wie die jährlichen Kosten für den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Abgesehen davon, dass die Kosten der Energiewende unnötig hoch sind und gesenkt werden könnten, wird auch die Verteilung der Lasten intensive diskutiert. Erstens entstehen erhebliche Umverteilungseffekte zwischen Bundesländern, zweitens sind die Kosten und Profite der Energiewende in der Bevölkerung sehr ungleich verteilt, und drittens werden Unternehmen in sehr unterschiedlicher Weise belastet. Was die Umverteilungseffekte zwischen Bundesländern angeht, sind nach Angaben des BDEW im Jahr 2012 über 1,2 Mrd. Euro netto nach Bayern geflossen, während Bürger und Unternehmen in Nordrhein-Westfalen mit netto mehr als 1,8 Mrd. Euro belastet wurden. Die Umverteilung erreicht zwar noch nicht das Volumen des Länderfinanzausgleichs, ist aber doch inzwischen so bedeutsam, dass sachgerechte Reformen erschwert werden. In der Bevölkerung findet durch die Energiewende eine Umverteilung vor allem von unten nach oben statt, also anders als ansonsten gewünscht. Während Grundbesitzer wie Landwirte (z.B. über die Pacht für ihre Flächen in Windgebieten oder das Aufstellen von Solarpanelen) sowie Immobilienbesitzer (durch die Installation von Solarpanelen) erhebliche Profite einstreichen können, müssen Mieter und verschiedene Gewerbe (wie z.B. Handwerksbetriebe) die Kosten der Energiewende im Wesentlichen tragen. Im Zentrum der öffentlichen Diskussion stehen aktuell vor allem die Ausnahmen für stromintensive Unternehmen des produzierenden Gewerbes. In der Tat wird nach Angaben des BDEW nur 47 % des industriell verbrauchten Stroms mit der vollen EEG-Umlage belastet, während 53 % des industriell verbrauchten Stroms nicht mit der vollen EEG-Umlage belastet wird. Letztere haben insbesondere 2013 sogar von gesunkenen Großhandelspreisen profitiert und können – solange diese Ausnahmen aufrechterhalten werden – sogar als Gewinner der Energiewende bezeichnet werden. Es ist allerdings festzuhalten, dass, selbst wenn sämtliche Industrieanlagen ausnahmslos mit der vollen EEG-Umlage belastet werden würden, die EEG-Umlage nur um maximal 1,5 Cent/kWh gesenkt werden könnte.
Читать дальше