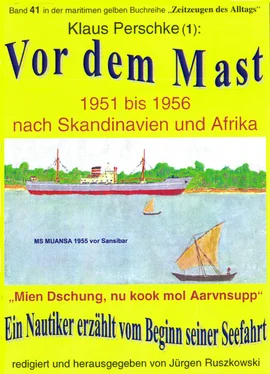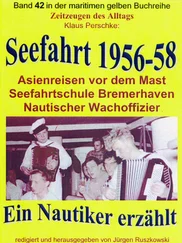Die „goldene Freiheit“ war für mich vorüber. Der große Chef war wieder zurück, und der große Chef würde uns jetzt zeigen, wo es längs geht. Grenzen zeigen: Bis hier her und nicht weiter. Der Versuch, die Grenze auszuloten, wie weit man beim Chef gehen konnte, ging voll daneben. Vater Willi, für den eine Welt und seine NS-Ideologie zusammengebrochen war, wollte unbedingt verhindern, dass seine Autorität bei seinen Söhnen auch noch in die Hosen geht. Und bei der ersten sich bietenden Gelegenheit, die gar nicht lange auf sich warten ließ, holte er gnadenlos alles nach, was er in der Zwischenzeit versäumt hatte.
Wir hatten Spätherbst, das heißt: viel, viel Regen, also Schietwetter, und es gab gleich zwei Anlässe zur Auseinandersetzung. Zum einen hatte Mutter Hilde Waschtag und benötigte dafür zum Einweichen der Wäsche die alte Zinkwanne im Waschkeller. Es war November, und auf Bauer Haacks Weiden waren die Gräben überflutet. Mit anderen Worten: Auch wir brauchten die Zinkwanne, denn wir wollten auf den überfluteten Gräben „schippern“. Wie man das macht? Nichts geht einfacher: Nun, man schlägt in den Ausgussverschluss einen Holzpfropfen, an den nagelt man einen Besenstil, der dann senkrecht nach oben steht und durch den Griff gehalten wird und befestigt daran ein improvisiertes Segel. Wie man sieht, war ich prädestiniert, Schiffbauer zu werden. Als Ballast hatten wir vorn am Mast Ziegelsteine zum Trimmen benutzt. Die Idee war gut, denn es funktionierte. Mein Vater hatte uns verwarnt: „Mutter braucht die Wanne, ist also nix mit segeln, verstanden?!“ Aber die Versuchung war zu groß, und wir hatten die Eltern sogar überlistet.
Nun, wer nicht hören will, muss fühlen. Ein altes deutsches Sprichwort, damals sehr geläufig bei uns zuhause. Wir wollten eben herausfinden, wie weit wir gehen konnten. Ich war zu weit gegangen. Meine Freunde Wolfgang Westphal und Manfred Frenser gaben Fersengeld und verschwanden plötzlich in der Ferne von Bauer Haacks Weiden. Mein Vater näherte sich mir in seiner sportlichen, britischen POW-Uniform, holte mich am Kragen aus der Wanne, klemmte meinen Kopf zwischen seine Beine und löste seinen Ledergürtel, alles ganz ruhig und gefasst. Und dann zog er mir 10 Schläge über den Hintern! Harte Vaterschläge! Früher hieß es bei der HJ: „Ein deutscher Junge ist flink wie ein Wiesel, mutig wie ein Löwe und hart wie Kruppstahl“. Vater Willis Einschläge waren härter als Kruppstahl, denn er war fit wie Ironman. In einem früheren Leben muss er garantiert ein Folterknecht gewesen sein. Wenn ich heute daran zurückdenke, dann zuckt mir immer noch mein damals grün und blau angelaufener Achtersteven. Das war im November 1947. Ein böses Jahresende! An diesem ausgebrochenen Vater-Sohn-Konflikt hat meine pubertierende Psyche jahrelang sehr gelitten.
Die Grenzen waren wieder klar abgesteckt und außerdem begann jetzt der Ernst des Lebens. Die Schulen wurden schon 1946 wieder eröffnet. Die erste Schule war die Deichschule in Cuxhaven-Mitte, direkt hinter dem Deich am Hafen. Und die Klassen waren voll, so voll, ich glaube zwischen 40 und 50 Schüler waren in einer Klasse zusammengepfercht. Dazu kam, dass die meisten Lehrer noch in Kriegsgefangenschaft oder noch nicht entnazifiziert waren. Anfangs hatten wir eine Doppelstunde Rechnen und eine Doppelstunde Deutschunterricht. Danach kam die nächste Klasse. Viele Flüchtlingskinder waren dabei; und es war lausig kalt im Winter 1947/48. Es gab keine Kohlen für die Schulen. Kohlen bekamen nur die Fischdampfer im Hafen. Trotzdem, wenn einer von uns nicht spurtete, dann bekam er für Kleinigkeiten von den heimgekehrten Lehrern mit dem Rohrstock mindestens fünf Schläge hinten übergezogen, und dabei wurde einem warm, und man kam mächtig ins Schwitzen. Der Rohrstock wurde sehr oft benutzt in der Deichschule. Damals hatten wir verdammten Respekt vor den heimgekehrten Lehrern. Wer hat heute noch vor den Lehrern Respekt? Manche haben übertrieben geprügelt, aber mein Vater gab immer den Lehrern Recht, niemals mir oder überhaupt uns Schülern. Schüler hatten Pflichten zu erfüllen, hatten also keine Rechte. So einfach war das im untergegangenen Reich gewesen. Nennt man so etwas nicht auch Generationenkonflikt?
Es war eine bescheidene Zeit damals. Der Schwarzmarkt blühte. Jugendfreunde, deren Väter die Kunst des Handels und des „schnellen Untertauchens“ auf dem Schwarzen Markt erfolgreich beherrschten und nie von der Polizei geschnappt wurden, liefen immer in den neusten trendy Klamotten herum, die damals gerade „in“ waren. Mein Vater, Ex-Marine-Verwaltungs-Offizier, also Marine-Oberzahlmeister oder auch „Silberling“ genannt, war eine absolute Niete im punkto „Anpassen an diese neue Zeit“. Es gab ja nichts mehr zu verwalten, es gab nur noch etwas zu organisieren, zu verschieben, also blieb er erfolglos, soll heißen „arbeitslos“. Die Sozialdemokraten in Cuxhaven waren, ob qualifiziert oder nicht, von den Siegern in alle öffentlichen Ämter verpflichtet worden und sollten für Ordnung sorgen. Man hatte etwas gegen alles, was früher nach Militär und Partei roch. Diese Leute wollte man nie wieder einstellen, denn sie hatten ja den böhmischen Gefreiten zum Führer gewählt, der den Krieg und den totalen Zusammenbruch gewollt hatte. Es ging nicht nur meinem Vater dreckig, es ging einem ganzen Heer von entlassenen Heimkehrern so. Es war ganz schön traurig. Nur eins vergaß mein Vater meistens, wenn er sich beklagte: „er hatte nämlich das Glück und die Gnade gehabt, aus den ganzen Schlamassel heil heraus gekommen zu sein, sogar unverwundet. Wie viele waren durch diesen gottlosen Krieg auf der Strecke geblieben?! In unserer Nachbarschaft wohnten etliche Kriegerwitwen, besonders von der U-Boot-Gattung. Trotzdem war Vater Willi unzufrieden. Schlangestehen vor dem Arbeitsamt mit alten Kriegskameraden, die auch keinen Job bekamen, war seine einzige Tätigkeit.
1948 waren wir vor der Währungsreform einmal für vier Wochen zum Torfstechen gefahren. Dafür gab es dann ein paar Säcke getrockneten Torf für den kommenden Winter. Ansonsten gab es ab 1948 jede Woche 34 D-Mark „Stütze.“ 1949 war meine kleine Schwester Sabine geboren worden. Sabine war so etwas wie unser kleiner Lichtblick, unsere Freude und Hoffnung in dieser trostlosen Zeit. Wenn sie lachte, vergaßen wir für einen Moment unsere bescheidene Lage. Als meine Schwester zwei Jahre alt war, nahm mein Vater diesen kleinen Wurm auch mit zum Arbeitsamt. Und wenn die arbeitslosen Kameraden Sabine fragten, was sie denn später einmal werden möchte, wenn sie groß sei, dann antwortete sie zum Gaudi der wartenden Kameraden: „Wenn ich einmal groß bin, dann gehe ich stempeln“!

„Zur Lage der Nation im Jahre 1948“
Aus der Sicht eines 13jährigen Jungen entwarf ich diese politische Karikatur. Meine überforderten Eltern nahmen sie gar nicht zur Kenntnis. Doch der Reklamemaler, Herr Krollmann, bei dem ich mich 1950 mit diesem Entwurf bewarb, war begeistert und meinte, diese Veranlagung wäre noch aufbaufähig. Leider hatte mir meine damalige Chefin, Frau Neubauer, einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Für mich hatte 1948 eine neue Schulstufe angefangen, d. h. meine Eltern hatten mich von der Volksschule in die Mittelschule gehievt, und anfangs lief auch alles gut. Nur, weil wir zuhause jeden Pfennig dreimal umzudrehen hatten, musste auch ich nach der Schule nachmittags Geld verdienen gehen. Durch Vermittlung unseres damaligen Pastors Arno Pötzsch von der Garnison-Kirche bekam ich einen Botenjob in der Buchhandlung von Hans Neubauer in der Schillerstraße.

In der Mittelschule, die in der Rathausstraße eingerichtet war, Klasse 7 k Gruppenbild mit Lehrer Tonn. Aufnahme von 1949.
Читать дальше