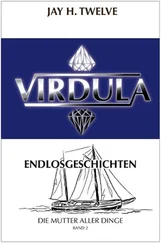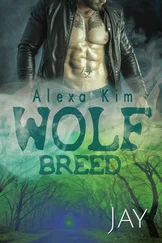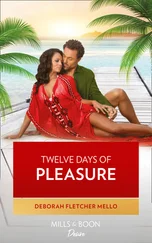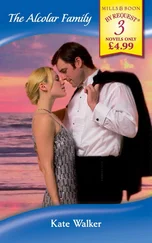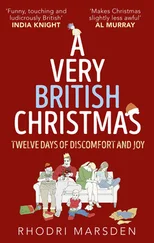Die Aborigines, insbesondere die alten Frauen, erklärten ihm vieles in gebrochenem Englisch und einfachen Bildern, die sie kunstvoll in den Staub des Bodens zeichneten. Sie vermittelten viel mehr Sachverhalte als die Nonnen, auch wenn er zunächst nicht alles verstand. Diese Bilder waren unvergleichbar einleuchtender, als die stereotypen Wiederholungen der Nonnen, die sich auf angeblichen Weissagungen von Propheten und Heiligen gründeten, die möglicherweise nie existierten. Don José konnte vieles von den Aborigines praktisch anwenden, denn er befand sich oft alleine in einer Umgebung, wo jeder Tropfen Wasser und etwas Essbares weit mehr zum Überleben beitrug, als das Anbeten von mystischen, heiligen Männern einer möglicherweise nie existenten Vergangenheit. Die alten Nonnen konnten sich diesen nutzlosen Luxus leisten, weil die regelmäßige Versorgung ihrer Mission von einer anderen Zivilstation besorgt wurde. Sie mussten auch keine Wasserknappheit und Hitze von 50° C im Schatten ertragen.
Die Aborigines dagegen beachteten das gespeicherte Wissen ihrer Ahnengeister vieler Generationen, das sie wie eine unerschöpfliche Bibliothek für das tägliche Überleben verwendeten. Genau diese Bibliothek wollte Don José eingehend erforschen.
Alsbald entdeckte er dass Begriffe, die die Aborigines für einen bestimmten Sachverhalt verwendeten, eine gezielte Denkrichtung in Gang setzten, womit hierfür benötigtes Wissen in der Bibliothek der Geisterwelt abgefragt werden konnte. Schon Jahrtausende zurück malten sie auf Felsen an ihren heiligen Plätzen die gleichen Begriffe, die sie für ihre spirituelle Kommunikation untereinander verwendeten. Für Außenstehende, die in einer anderen Kultur groß geworden waren, die durch andere Begriffe und Zeremonien geprägt worden waren, war es nicht möglich diese Kommunikation zu verstehen, geschweige denn irgend etwas Sinnvolles aus dem Gesang und Tanz der Aborigines zu gewinnen.
Der junge Don José nutzte solche seltenen Gelegenheiten, die sich bei Begegnungen mit den „noch wilden Aborigines“ ergaben, um unvoreingenommen und mit geschlossenen Augen aufmerksam zuzuhören. Hinterfragen konnte er diese Menschen kaum, weil ihm deren Welt so fremd und doch so vertraut vorkam. Fast so vertraut, als schlummerte irgendwo eine Welt in seinem Gedächtnis, die er nur vorübergehend vergessen hatte.
Nach solchen Erlebnissen mit den Ureinwohnern Australiens beschäftigten ihn seltsame Träume, die von solcher Intensität waren, dass er sie im wachen Zustand als Wirklichkeit empfand. Er träumte von wunderschönen Landschaften und Felsen, von deren Höhen er diese Gegenden weit überblicken konnte. Von einem großen See, so dunkelgrün von Wäldern umringt, still, als gäbe es keinen Wind, der die glasklare Oberfläche in ihrer Farbharmonie stören könnte. Von einem Felsen, von welchem er immer seinen imaginären Flug über den See startete.
Er war sich seiner menschlichen Gestalt im Traum bewusst, auch die abgewetzte lederne Umhängetasche die ihn überallhin begleitete, die quer über die Schulter hing. Bevor er seinen Flug startete, band er diese, für ihn wichtige Tasche gewissenhaft an seinem Hosengürtel fest, damit sie nicht während des Fluges herumwirbelte. Als er sich dann schließlich in die Schlucht hinein stürzte und mit zunehmender Geschwindigkeit den grünen See und die dahinter stehenden Bäume überflog, wurde er von einem unbeschreiblich erhabenen Gefühl erfasst. Dieses Gefühl, über Landschaften zu fliegen und alles wie mit Adleraugen wahrnehmen zu können, zugleich das ganze Bild als auch die winzigen Details, waren unbeschreiblich schön anzusehen. Sobald er den See und die Wälder überflogen hatte, fand er sich plötzlich in der realen Welt des australischen Outbacks wieder. Er setzte seinen Flug weiter fort, als wollte er die Landschaft vorab erkunden, damit er morgen genau wissen würde, wohin er mit seinem Land Rover fahren sollte.
Diese Träume begleiteten ihn die ganze Reise lang, Nacht für Nacht, ohne Ausnahme. Er stellte allerdings mit Verblüffung fest, dass die geträumten Landschaften mit der Realität übereinstimmten und er sich bei der Navigation durchaus auf die Traumroute verlassen konnte. Er nahm diese Erfahrung als selbstverständlich an und freute sich wie ein kleiner Junge, wenn die geträumte Landschaft mit der Strecke, die er gerade mit dem Auto fuhr, gänzlich identisch war. Ihm erschien hier in der Wildnis alles anders und vieles Utopische möglich, weil die Einsamkeit in der unberührten Natur eine eigene geistige Welt beherbergte, deren Einwirkung auf seinen seelischen Zustand berauschende Erkenntnisse zu Tage förderte.
Mit der Zeit festigte sich in ihm die Überzeugung, dass er anfing sich an Empfindungen zu erinnern, die in laufenden Generationen seiner Ahnenreihe verloren gegangen schienen. Der junge Don José verinnerlichte allmählich den Rhythmus der Wildnis. Er empfand Eindrücke an bestimmten Plätzen der endlosen Wildnis, die ihm Wohlbefinden oder Unbehagen bereiteten. Immer vor Sonnenuntergang suchte er eine geeignete Stelle, wo er sein Nachtlager herrichten konnte und befragte die Umgebung im Geiste, ob er da auch willkommen sei. Das äußerte sich darin, dass er an bestimmten Plätzen entweder eine merkwürdig liebliche Geborgenheit des Ortes wahrnehmen konnte, oder ein kribbelndes Unbehagen empfand, als wenn er in diesem Moment mit der Erde kommunizierte.
Diese real gewonnenen Erfahrungen übertrug er in seine nächtlichen Träume. Er befragte die Landschaft, während er sie im Traum überflog. Das machte er nicht auf visuelle Weise, sondern rein gefühlsmäßig. Wenn sich Don José in einer bestimmten Gegend mehrere Tage aufhielt, weil ihn die Bodenbeschaffenheit und die Umgebung besonders interessierten, stellte er bald fest, dass gerade in solchen einladenden Gebieten keinerlei Spuren von Erzvorkommen lagen, dafür aber unterirdische Wasservorräte vermuten ließen.
Zu seiner Ausrüstung gehörten auch ein ausziehbares Thermometer und ein Feuchtigkeitsmessgerät, die in einem Behälter aus Glas und emailliertem Blech untergebracht waren. Der senkrecht gelagerte Zylinder des Messgerätes, den man wöchentlich mit einem neuen vorgedruckten Papier bespannte, funktionierte wie ein Uhrwerk, das man mit einer Spiralfeder aufziehen konnte. Zwei seitlich hängende Tintenschreiber zeichneten über einen Arm jeweils die Temperatur und die Feuchtigkeitsschwankungen auf.
In dem australischen Outback verhielt es sich ähnlich wie in allen anderen Wüstenlandschaften. Tagsüber kletterte das Thermometer bei extrem trockener Luft auf 45° bis 50° C und in der Nacht fiel die Temperatur bis auf 10° bis 15° C, wobei die Feuchtigkeit erst kurz vor Sonnenaufgang spürbar anstieg. Die Messungen an solchen speziell angenehmen Plätzen zeigten wesentlich geringere Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Man sah, dass die Aborigines bei ihren ständigen Wanderungen gerade solche Plätze als Raststätten bevorzugten; Spuren verloschener Lagerfeuer und herumliegende Tierknochen bestätigten dies.
Ganz am Anfang seiner Exkursion in das Landesinnere kannte sich der junge Don José kaum in Zoologie und Biologie der neuen Heimat aus. Seine Kenntnisse waren auf wenige Eukalyptusbaumsorten, Dingos, Kängurus, Schlangen, Krokodile und Kakadus beschränkt. Mit der Zeit und insbesondere durch den Kontakt mit den Aborigines, Viehzüchtern sowie Abenteurern, denen er unterwegs begegnete, lernte er schnell die Vielfalt der scheinbar spärlichen Vegetation und Tierwelt kennen. Dieser Lernprozess vollzog sich vorwiegend am Lagerfeuer oder auf einer Veranda bei den Viehzüchtern, die mangels sonstiger Themen gerne über giftige Spinnen, Schlangen und verschlagene Dingos erzählten. Der unterhaltsame Unterricht durch die weißen Siedler und Landstreicher unterschied sich gravierend von der Betrachtungsweise der Aborigines. Die weißen Siedler selektierten die Lebewesen in nutzbar oder schädlich, harmlos oder gefährlich. Nach diesen Kriterien wurden diese Wesen verbraucht, vernichtet oder ignoriert.
Читать дальше
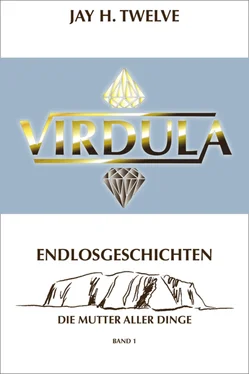
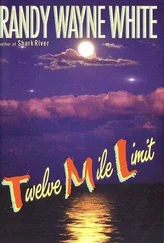
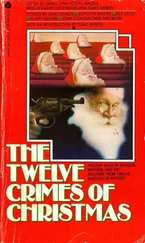
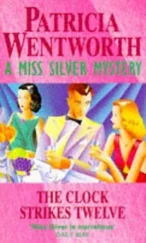
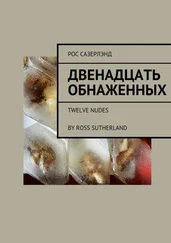
![Twelve Angel - Супер Ген Бога. Том 13 [1201-1300 главы]](/books/408699/twelve-angel-super-gen-boga-tom-13-1201-thumb.webp)