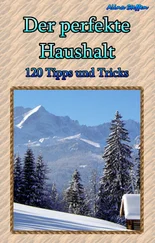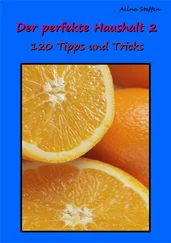»Es war in den späten vierziger Jahren. Opa und ich bestanden auf der gleichen Schule unsere Matura, beide mit einem guten Ergebnis, und sahen uns beim Abschlussball vorerst zum letzten Mal. Seine eisblauen Augen, die sein optisches Kapital waren, sind mir schon damals aufgefallen, aber in diesen Jugendjahren traute ich mich nicht, ihn anzusprechen. Nach der Matura begannen wir beide ein Studium in Breslau, das war 1950. Und obwohl sich unsere Wege an der Universität häufig kreuzten, traute ich mich immer noch nicht, diesen gut aussehenden jungen Mann anzusprechen. Gleichwohl gab ich ihm zu verstehen, dass er es wagen solle. Und er tat es. Wir lernten uns kennen und heirateten während des letzten Studienjahres. Und da uns nach dem Diplom hier auf dem Lande eine Anstellung zugeteilt wurde, sind wir hierhergezogen.
Opa wurde 1955 bei der neu eröffneten Ortsverwaltung eingestellt und eine seiner ersten Aufgaben bestand darin, für den regionalen Parteivorstand einen Unterhaltungsabend mit dem dazugehörigen Abendprogramm zu organisieren, damit sich die Herren Genossen nach einer anstrengenden Tagung von ihrer Partei erholen und ablenken konnten. Jedenfalls muss ihnen die Erholung sehr gutgetan haben, denn schon am Folgetag fragte Genosse Gierek kurz vor der Abreise, wer für die Organisation zuständig gewesen war. Als Opa aus der Reihe der sich Verabschiedenden vortrat und sich militärisch dem Genossen Gierek vorstellte, schrie dieser laut heraus: Das ist der perfekte Mann! Der perfekte Mann für die Stelle des Projektleiters, den wir gestern Nachmittag verzweifelt gesucht haben.
Auf diese Weise kam Opa zu seiner Anstellung. Seit über dreißig Jahren arbeitet er jetzt in der Stadt und fährt jeden Tag mit dem Fahrrad ins Büro.«
Der Sommer 1982 war sehr heiß und einer der schönsten, an die ich mich erinnern kann. Vermutlich ist die Hälfte meiner Erinnerungen eine Konstruktion meines Unterbewusstseins und allzu viele Geschichten aus dieser Zeit kommen mir nicht mehr in den Sinn. Aber ich kann noch gut meine Enttäuschung nachvollziehen, als sich der wochenlange Aufenthalt bei meinen Großeltern seinem Ende zuneigte. Nach Wochen, in denen mir die Großeltern abwechselnd die tollsten Geschichten erzählt und viele neue Dinge beigebracht hatten, rückte die Zeit der Abreise näher und näher.
Mit der Absicht, mich pünktlich zum Schuljahresanfang zurück nach Lodz zu bringen, erschienen kurz vor dem Ende der Sommerferien meine Eltern. Die gegenseitige Freude über das Wiedersehen fiel selbstverständlich riesig aus. Schließlich hatte ich meine Eltern seit Wochen nicht mehr zu Gesicht bekommen. Andererseits wurde mir bei ihrer Ankunft der immer näher rückende Abschied von meinen Großeltern deutlich, was mich traurig stimmte. Glücklicherweise kündigte meine Mutter am Abend während des Abendbrots die Aussicht auf ein rasches Wiedersehen an, das zu Weihnachten stattfinden sollte.
Meine Betrübtheit schlug innerhalb weniger Sekunden um 180 Grad in Begeisterung um.
Oma Marie und Opa Lucian waren ebenfalls einverstanden und nahmen die Einladung dankend an. Insbesondere, weil sie dadurch meine Eltern ein wenig unterstützen konnten. Denn im Hinblick auf die Lebensmittelknappheit, die seit dem letzten Winter herrschte und in den Städten viel heftiger zu spüren war als auf dem Lande, hatten sie den Eindruck, ihren Kindern verstärkt zur Seite stehen zu müssen. Im Vergleich zu unserem städtischen Kühlschrank war nämlich der meiner Großeltern recht ordentlich gefüllt. So ordentlich, dass meine Mutter seinen Inhalt vor der Abfahrt nach Lodz von Oma in Butterbrotpapier einpacken ließ und außer Licht nur wenig im Kühlschrank übrig blieb.
Ein neues Schuljahr hatte angefangen und der Alltag kehrte in die Bildungsanstalten der Volksrepublik Polen ein. Mit der Genauigkeit eines schweizerischen Uhrwerks fanden morgens die Schulappelle mit den üblichen Parolen statt, gegen zwei Uhr nachmittags wurde man nach Hause entlassen und versuchte, sich auf irgendeine sinnvolle Art zu beschäftigen, bis ein Elternteil eintraf.
Eines Tages erledigte ich die Hausaufgaben und erschrak beinahe, als meine Mutter in die Einraumwohnung stürmte. Sie tat es mit einer Vehemenz, die mich glauben ließ, der dritte Weltkrieg sei ausgebrochen und sie müsse unser gesamtes Hab und Gut vor der einmarschierenden Armee retten.
Ihren Mantel und ihre Handtasche schleuderte sie auf das Sofa und holte sowohl für mich als auch für sich selbst eine warme Jacke aus dem Kleiderschrank. Meine warf sie mir zu und sprach mit lauter Stimme: »Zieh sie an, wir müssen sofort zur Post, ein Telegramm aufgeben! Drüben im Einkaufszentrum ist gerade die Hölle los!«
Meine Mutter war außer Atem, da sie schnellstmöglich in den fünften Stock gerannt war, wo sich unsere Wohnung befand. Die Ausnahmesituation musste nicht betont werden, das wurde mir sofort deutlich. So befolgte ich, ohne eine Frage zu stellen, ihre Anweisungen, versuchte noch die Schuhe anzuziehen, schaffte aber nur, den Klettverschluss des linken Schuhs herunterzuziehen. Dann rannten wir die fünf Stockwerke hinunter zur Tramhaltestelle, um die heranfahrende Straßenbahn gerade noch zu erwischen. Dass ich dabei den rechten Schuh verlor, entging meiner Mutter in der Hitze des Gefechts völlig. Erst nach einem lauten Geschrei von meiner Seite realisierte sie das Unglück und kehrte um, während ich mich auf das Trittbrett der Straßenbahn stellte und wartete, bis sie nachkommen würde. Sie holte den Turnschuh von der Fahrbahn und sprang fuchsteufelswild in die Tram. Wir setzten uns nebeneinander und sie reichte mir wortlos den Schuh. Ich mied ihren Blick und zog den Klettverschluss hoch, um hineinzuschlüpfen.
Mutter war noch lange außer Atem.
Nachdem die Tram die gewünschte Haltestelle beim Postgebäude erreicht hatte, stürmte meine Mutter auch diese Treppe hinauf und rannte auf den Telegrammschalter zu, der – wie so oft in der damaligen Zeit – nicht besetzt war. Die gute Fee am Schalter hatte ihr Tagessoll an Telegrammen vermutlich übererfüllt und entspannte sich mit ihrer Arbeitskollegin vom Schalter für Sammelmarken bei gut verdünntem Tee und harten Weizenmehlkeksen.
Mutter hüpfte von einem Bein auf das andere und gab der Postbeamtin, die abseits saß, zu verstehen, dass es pressiere. Gleichzeitig unternahm sie den taktisch sinnvollen Versuch, nicht zu arrogant zu erscheinen und das Feingefühl der Staatsangestellten nicht zu verletzen, wodurch sich die Pause erheblich verlängert hätte. Schließlich stand die Beamtin von ihrem Stuhl auf, trat sichtlich genervt dem Telegrammschalter näher und nahm die Adresse meiner Großeltern auf, an die das Schreiben gerichtet war. Nachdem sie die Empfängeradresse eingetragen hatte, senkte sie die Kugelschreibermine auf das Formularfeld Nachricht . Dann nickte sie, schaute erwartungsvoll in Mutters Gesicht und gab so zu verstehen, dass sie bereit sei. Um potenzielle Fehlerquellen zu vermeiden, diktierte meine Mutter den Text langsam und deutlich: »KOMMT SOFORT NACH LODZ! WASCHMASCHINEN ZU KAUFEN, AUCH OHNE WARTELISTEN! SOPHIE.«
Mir war der Ernst der Sache durchaus klar. Waschmaschinen waren in der polnischen Planwirtschaft keine Selbstverständlichkeit und durchaus erwähnenswert. Aber nachdem meine Mutter die einzelnen Wörter ausgesprochen hatte, veränderte sich das Gesicht der Postbeamtin wie das eines Kindes, das gerade das schönste Weihnachtsgeschenk bekommen hat. Ihren weit aufgerissenen Mund und ihre tränenden Augen werde ich nie vergessen.
Noch in derselben Nacht nahm Oma Marie das Telegramm entgegen. Ob sie auf die Neuigkeit genauso reagierte wie Mutter oder die Postangestellte, kann ich nicht beurteilen. Ich wage es aber zu bezweifeln, denn ich erlebte Oma Marie zwar als eine sehr liebevolle Person, aber ihre Gefühle beherrschte sie immer. An der Tatsache, dass sie Opa dennoch rumgekriegt hat und beide durch die folgende Nacht einer erhofften neuen Waschmaschine entgegengefahren sind, ändert das nichts. Kurz vor fünf kamen sie in Lodz an und klingelten meine Eltern aus dem Schlaf.
Читать дальше