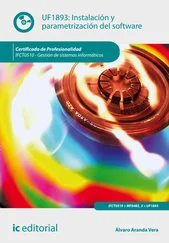Vera Bachauer
treulos
Rückblick einer Ehebrecherin
Dieses eBook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis
Titel Vera Bachauer treulos Rückblick einer Ehebrecherin Dieses eBook wurde erstellt bei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Impressum
1.
Ich bin eine geborene Achtundfünfzigerin. Meinen Schülern erkläre ich: ein spätes Nachkriegskind. Die Schafwollstrumpfhose kratzte so schrecklich, dass ich froh war, endlich die heiß geliebten Kniestrümpfe anziehen zu dürfen, sobald der Sommer in unsere Lausitz einzog. Ob zum Spielen die geringelten und ewig gestopften Strümpfe oder zu den Sonntagsspaziergängen die weißen; egal dass sie rutschten und sich über den Rand der Sandalen stülpten, ich war ein glückliches Kind. Und irgendwann gab es auch diese kratzigen Strumpfhosen nicht mehr. Mutter schickte mich zur Molkerei. Die dicke Frau hinter der Theke schöpfte die zulässige Familienration mit einer großen Kelle in meinen Milchkrug, setzte einen Strich auf eine Liste, ehe sie das Stück Butter überreichte und der Quark wurde abgewogen in ein Stück Pergamentpapier gewickelt. Ich verabschiedete mich brav, der Duft von würzigem Käse blieb in der Nase hängen – bis heute. Daheim wurde die Milch abgekocht und wenn sie abkühlte, ekelte ich mich zu Tode. Milch ist gesund, basta! Oma Meta rollte böse mit den Augen, wenn wir Kinder die allmorgendliche Pudding- oder Haferflockenmilchsuppe mit Verachtung aßen, weil dicke, gelbliche Hautfetzen auf der Oberfläche schwammen. Wir mussten aufessen! In dieser Zeit wurde nichts weggeworfen. Der Kriegshunger saß noch fest in den Köpfen. Besonders bei meinem Vater. Ein traumatisches Milchbrötchen-Erlebnis aus seiner Kinderzeit lässt ihn nicht los. Die Kinderschar von damals, die den kleinen Pit und das Brötchen in seiner Hand umringte, blieb ein Albtraum für ihn und wurde einer für uns. Wollten wir nicht essen, zogen Gewitterwolken über den Küchentisch, die Eltern blieben hart, selbst wenn der Erbsenbrei im Mund immer mehr wurde und Erstickungstod drohte. Noch heute ruft Vater entsetzt aus der Küche: Soll ich dir was zu essen machen, du siehst so abgemagert aus! Dabei habe ich gerade vier Kilo zugenommen, weil ich nicht mehr rauche. Man kann ja nicht verübeln, dass meine Eltern alles daran setzten, ihre drei Kinder satt und zufrieden groß zu kriegen.
Meine Kinder wurden nicht zum Aufessen gezwungen, wuchsen in dem herrlichen Zeitalter teilentrahmter, wärmebehandelter Milch auf und warfen Schulbrote weg, wenn kein Nutella drauf war. Heimlich. Denn das kann ich auch nicht leiden!
Ich bin ein Nachkriegskind, das Verschwendung nicht kannte. Meine Mutter führte akribisch ein Haushaltsbuch und als Vater Alleinverdiener wurde, weil der Storch noch ein Schwesterchen in den Stubenwagen legte, musste die DDR-Mark noch einmal mehr umgedreht werden, bevor Mutti sie ausgab. Sie rechnete genau und manchmal schickte sie mich noch einmal in den Gemüseladen, weil die Verkäuferin versucht hatte mich um einige Groschen zu prellen. Mit Kindern kann man es ja machen! Warum ist meine liebe Mama eigentlich nicht selbst hingegangen, um das fehlende Geld einzutreiben? Stattdessen jagte sie mich mit einer schriftlichen Beschwerde zurück und schimpfte über die Hochstaplerin im Laden und den Tollpatsch von Tochter. Aber meine Mathematikkenntnisse wurden auch dadurch nicht besser, dass ich zum Einkaufen geschickt wurde. Manchmal blieb ein Groschen übrig und den durfte ich Glückliche in eine Zucker- oder Lakritzstange eintauschen. Und so beließ ich es gern dabei, meiner Mami die kleineren Käufe abzunehmen. Meine beiden Geschwister waren klüger. Sie bekamen die Zuckerstange auch so. Mathias, Muttis Liebling, brauchte nur ein bisschen schmusen und Kristin, die Jüngste und damals noch Vaters Sonnenschein, heulte ganz kurz mit ihrer Sirenenstimme auf, um sofort ans Ziel zu gelangen. Ich war schon immer so: gutmütig, hilfsbereit, uneigennützig, solidarisch, naiv und dumm. Während ich mit dem Staublappen durch die Stube fegte, um Mutti eine Freude zu machen, trollten sich meine Geschwister zu ihren Freunden auf den Spielplatz. Meine Hof-Freunde waren Terroristen. Ich musste ins eklige Spinnennetz greifen, damit ich am Kinderfest teilnehmen darf. Lachend liefen sie davon, ich heulend an Mutters Rockzipfel. Das Fest hatte nie stattgefunden und ich könnte mich heute noch selbst verprügeln, dass ich immer wieder auf diese kindlichen Bestien reingefallen war. Erst meine späteren Schulfreundinnen gaben mir den Glauben an wahre Freundschaft zurück.
Trotzdem war ich war ein glückliches Kind. Als Mutti den weißen Krankenschwesterkittel gegen die bunte Hausschürze eintauschte und sieben Jahre auf das Geldverdienen verzichtete, nahm sie sich besonders viel Zeit für uns. Sie konnte so herrlich Geschichten erzählen aus ihrer eigenen geliebten Kindheit, zeigte uns stolz ihre Schönschreibhefte aus Klasse 1 und las aus ihren wohlbehüteten Kinderbüchern vor. Dabei leuchteten die Augen geheimnisvoll und Mutter entschwand in alte Zeiten. Die Augen verdunkelten sich, wenn sie ein trauriges Kapitel aufschlug: Mit fünf Jahren hatte sie ihren Vater zum letzten Mal gesehen - und noch Jahre lang hastete Klein-Thea nach der Schule nach Hause: Heute wird er auf dem Küchenstuhl sitzen und schon ungeduldig auf mich warten! Die Hoffnung starb, als die Gefangenentransporte aus Russland eingestellt wurden. Meine Oma rannte nicht mehr täglich zum Bahnhof und teilte das Schicksal aller Kriegswitwen, für ihre beiden Töchter allein zu sorgen. Sie hatte nicht wieder geheiratet, zog aus dem Hinterhof in das dreistöckige Vorderhaus und teilte später ihre große Wohnung mit meinen Eltern und mir, weil die DDR „lebenslänglich“ an akutem Wohnungsmangel litt. Oma Meta teilte ihr Reich auch noch mit meinen Geschwistern und war schlimm traurig, als wir eine Plattenbau-Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung ergattert hatten. Da war ich schon achtzehn. Das halbe Zimmer bekamen wir drei Kinder und ich wäre glücklich darüber gewesen, hätten wir Oma nicht alleine lassen müssen. Wir vermissten sie. Wir vermissten das alte Haus, den langen dunklen Flur, in dem ich mit meinen Geschwistern spielte und mit Oma die weißen Bett-Tücher spannte, Ecke auf Ecke zusammengelegt, bevor sie im Leiterwagen zur „Rolle“ gezogen wurden. Während die großen Wäschestücke unter einem zentnerschweren, knarrenden Holzkasten in die Mangel genommen wurden, verfolgte ich dieses Schauspiel begleitet von Respekt und kindlich gruseligen Phantasien. In der Küche stand ein uralter Herd, auf dem Mutter im Winter Brotscheiben brutzelte und uns Kinder unter dem Tisch hervorlockte, wenn es so verführerisch duftete. Mathias warf dann das Brotkorb-Lenkrad erst mal bei Seite und vergaß sieben Stullen lang, dass er gerade mit seinen Schwestern in den Urlaub fahren wollte. Dieser uralte Herd setzte einmal ein Handtuch, das zum Trocknen darüber hing, in Brand und später Omas Haare, während sie Feuer machte. Gott sei Dank war ich in beiden Fällen zur Stelle und reaktionsschnell, was man sonst nicht von mir behauptete. Die Küche war alles in einem: Tagesraum, Spielzimmer, Wasch- und Trockenzimmer, auch mal ein Zirkus. Mutter zog extra ihr blaues Brokatkleid und ihre Stöckelschuhe an, holte die Nachbarn, die den Flur mit uns teilten und kündigte die Attraktionen an. Mathias zauberte unter Opas Schornsteinfegerhut ein Plüschkaninchen hervor und ließ es über die gespannte Wäscheleine balancieren, auf meinen Schultern turnte die zweijährige Kristin. Donnernder Applaus!
Читать дальше