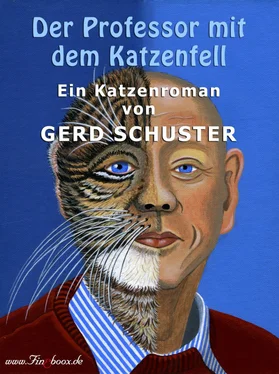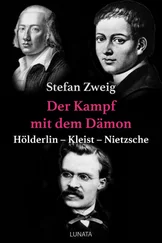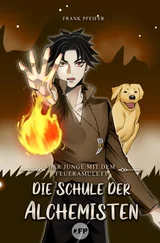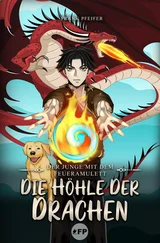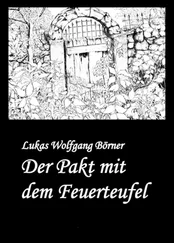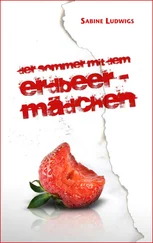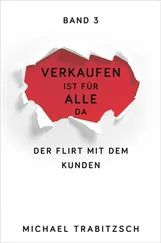Er schüttelte den Kopf. Welch ein Morgen! Erst dieser wirre Traum, der ihn so erschüttert hatte, dann Hasenklees Anruf! Hoffentlich ging der Tag nicht so weiter! Er entleerte seine Blase und suchte Sammi.
Im Schlafzimmer war sie nicht, auch nicht im Wohnzimmer. Plötzlich packte ihn eine wilde Angst, ihr könnte etwas passiert sein, und er hastete ins Gästezimmer. Hier war sie auch nicht. Oder doch? Er knipste das Licht an, kniete sich hin und schaute unters Bett: Utnapischtim lag auf seinem Polster aus Einkaufsbeuteln und funkelte ihn mit zurückgelegten Ohren fluchtbereit an. Die grafitgraue Haube, die den in sein Schädeldach implantierten walnussgroßen »Stecker« bedeckte, sah aus wie eine winzige Chamulka, ein »Judenkäppi«.
»Entschuldigung, Pischti!«, sagte der Professor. »Kein Grund zur Panik. Ich hab nur Sammi gesucht. Schlaf schön weiter! Es ist alles in bester Ordnung!« Aber der Kater stand auf, Angst in seinen riesengroßen braunen Augen, kroch mit eingezogenen Beinen und sich nach ihm umblickend, zur anderen Seite des Betts, und schoss davon, dass die Teppichbodenfasern durch die Luft stoben.
Schlichtkohl wünschte, wie so oft, er könne Pischti helfen. Er hatte den großen dünnen, schwarzbraun gefleckten Kater mit den mühlradgroßen Augen aus einem Institut für Epilepsieforschung gestohlen und ihn vor dem sicheren Tod bewahrt. Versuchstiere wurden nach Abschluss der Experimente routinemäßig eingeschläfert.
Er war bei einem Besuch der Tierlabors und der Versuchstierhaltung eines internationalen Pharmakonzerns, den ihm Gotthard ermöglicht hatte, auf den Kater aufmerksam geworden. Als er von einem Mitarbeiter des Multis, der ihm mit Bedacht nur relativ Unverfängliches zeigte, in den Wohnraum der »Steckerkatzen« geführt worden war, hatte ihn Pischti auf seine Weise begrüßt. Von einer kleinen Plattform an der Spitze eines Kletterbaums hatte er ihm eine Unzahl von Nasenküsschen gegeben.
In der weiß gekachelten Kammer, die von einem kleinen Radio beschallt wurde (»Damit sie sich an menschliche Stimmen gewöhnen können!« hatte sein Führer gesagt), war ein bunter Schwarm von etwa zwanzig Katzen herumstolziert. Alle hatten gesund und wohlernährt ausgesehen, und einige waren ihm sogar maunzend um die Beine gestrichen. Aber sämtliche Tiere trugen auf der Schädeldecke den eigelbgroßen flachen Hügel aus Zement – oder was immer es war – mit einem oder zwei Steckerschlitzen.
Durch diese Schlitze schoben Forscher Minielektroden ins Katzenhirn. Sie reizten bestimmte Areale mit elektrischen Impulsen, sodass die Tiere einen epileptischen Anfall erlitten. Auf diese Weise testeten die Wissenschaftler, ob und wie gut Antiepileptika wirkten – Medikamente gegen die Fallsucht.
Er hatte damals gleich gewusst, dass er den Kater befreien musste. Er hatte vorgegeben, begriffen zu haben, wie unersetzlich die Tierversuche seien und das in einem Artikel zum Ausdruck bringen zu wollen. Für »Recherchen« war er mehrfach in dem Labor aufgetaucht. Er hatte sich die Tastenkombination des Zahlenschlosses gemerkt, das den Katzenraum öffnete. Drei Wochen später hatte er sich unter dem Vorwand, Durchfall zu haben, von seinem Wächter entfernt, den Raum geöffnet, den Kater gepackt, mit Äther betäubt, in eine Reisetasche gesteckt und aus dem Institut getragen, seine blutenden Kratzwunden sorgfältig verbergend.
Die Laborleitung wusste wahrscheinlich, wer der Dieb war; man hatte aber nichts unternommen. Schlichtkohl nahm an, dass man Aufsehen scheute.
Pischti gab weiterhin Dutzende von Küsschen, wenn er auf einem erhöhten Ansitz hockte; aber er ließ sich auch nach zwei Jahren noch nicht anfassen. Die Haube aus weichem Leder, die ihm Schlichtkohl genäht hatte und die von Klettband auf dem Stecker festgehalten wurde, trug er allerdings klaglos.
In der Küche fand der Professor Sammi endlich. Eifrig schleckte sie ihren selbstgemachten Joghurt. Ihr ganzer Körper verriet die Konzentration, mit der sie zu Werke ging. Er schien im Moment der ersten Zungenberührung mit der Dickmilch mitten in der Bewegung eingefroren und war wie eine Sehne gespannt. Sogar der Schwanz stand starr waagerecht in die Luft, halbhoch mit einer Kurve im letzten Drittel – eine trinkende Bronzestatue.
Auf einmal machte Sammi eine Pause. Sie setzte nur ein oder zwei Schlabberschlucke lang aus, aber schon war die »Bremse« gelockert, die Schwanz und Körper hydraulisch arretiert hatte. Der Schwanz sank, seine Linkskurve öffnete sich. Doch da ging das Schlabbern weiter, und wieder setzten Standbild-Starre und Stock-Steife ein. Zwei Zentimeter über dem Boden kam der Schwanz zum Stillstand. Sammi war wieder zu einem Standbild mit wieselflinker Zunge geworden.
Kein Wunder, dachte der Professor. Er hatte seine Mieze oft genug beobachtet und erkannt, dass sie beim Trinken drei- bis viermal pro Sekunde das Mäulchen öffnete, die Zunge herausschnellen ließ, sie krumm wie eine Schöpfkelle in die Milch tauchte, zurückzog, an den Lippen, am Gaumen oder wo auch immer abstreifte und wieder ausfuhr. Das Dreiecksmaul arbeitete so rasch, als stritte sie sich lautlos auf sizilianisch. Da sie auch häufig schluckte, war Trinken eine überaus beeindruckende Koordinationsleistung, die ohne ein Höchstmaß an Konzentration undenkbar war.
Vor ein paar Monaten hatte die Katze damit begonnen, an ihrem Milchschälchen nur zu nippen und den Rest so lange unberührt zu lassen, bis er zu einer Art Joghurt geworden war. Schlichtkohl war überzeugt, dass Absicht dahinter steckte. Auf jeden Fall war das Prinzesschen sehr erbost gewesen, als er zu Anfang – damals hatte er die feline Fermentation noch nicht als gezielte Aktion durchschaut – die Näpfe mit dem vermeintlich ungewollten Überrest weggenommen und ausgespült hatte.
»Schmeckt’s?«, fragte er. Keine Antwort. Beim Essen sprach man nicht, bedeutete das wohl. Also wartete der Professor, bis seine Katze ihr Mahl beendet hatte und ihren Kopf schüttelte, dass er wie ein Flugzeugpropeller zu einem Schemen verschwamm und winzige Dickmilchtropfen in alle Himmelsrichtungen davonstoben. »Hat’s geschmeckt?« wiederholte er seine Frage. Sammi schaute auf und sagte stimmlos und mehr gehaucht als gesprochen, aber mit großer Bestimmtheit: »Ja–a!!!«
Ein Schwall von Zuneigung und Liebe durchströmte Schlichtkohl. Er bückte sich und streichelte ihr zärtlich über Kopf und Rücken, den sie ihm prompt entgegenwölbte.
Das »Ja–a!!!« war eine Variation von Sammi Monopol–Laut »A!!!« und wurde von der Katze meist zur Bestätigung eingesetzt. Er glaubte nicht, dass es auf dem Erdball noch eine Katze gab, die »Ja–a!!!« oder »A!!!« sagen konnte. Auf jeden Fall war ihm auf keiner seiner Reisen und auf keiner Katzenshow dieses offene, gehauchte, beinahe wegwerfende, meist stimmlose A, das Sammi mit Verve vortrug – ja, beinahe ein wenig ausspie – je zu Ohren gekommen.
Bei aller Einmaligkeit war das »A!!!« ein Mehrzwecklaut. Sammi sagte »A!!!«, wenn man sie weckte – hier bedeutete es so etwas wie »Huch!« – und wenn sie zu ihm kam, um Zärtlichkeit zu tanken. Dann war es wohl ein freundliches »Sei mir gegrüßt!« oder »Na endlich bist du wieder da!« »A!!!« war auch angesagt, wenn er ihren Brekkies-Napf vor dem Schlafengehen noch einmal unter ihren kritischen Augen auffüllte – für den kleinen Hunger in der Nacht. Hier war es ein Laut der Zufriedenheit und bedeutete etwa »Na also!«
Je nach Bedeutung war die Aussprache des »A!!!« ganz verschieden. Es konnte staunend, erschreckt, heiter, abwehrend, dankbar, interessiert, ja sogar neutral klingen. Und tadelnd: Wenn er Sammi beispielsweise von ihrer Lieblingsdecke hob, obwohl sie gerade so bequem auf ihr ruhte, war das »A!!!« ein sanfter Protestlaut. Dann bedeutete es wohl »Hee! Was soll das?«
Am liebsten hörte Schlichtkohl die einzige stimmhafte Version des »A!!!« – ein zärtliches, piepsig-helles Stück Katzenbabysprache, das Sammi nur in Momenten großer Zuneigung und heißen Katzenglücks benutzte.
Читать дальше