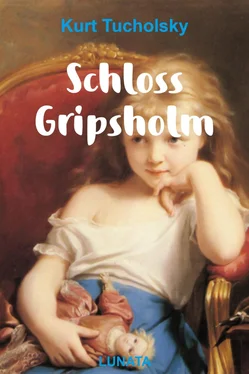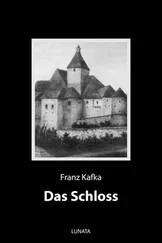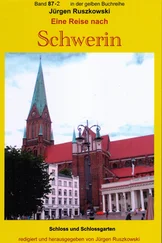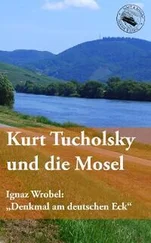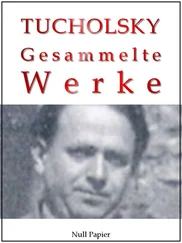Kurt Tucholsky - Schloss Gripsholm
Здесь есть возможность читать онлайн «Kurt Tucholsky - Schloss Gripsholm» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Schloss Gripsholm
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Schloss Gripsholm: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Schloss Gripsholm»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Schloss Gripsholm — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Schloss Gripsholm», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Schloß Gripsholm
© 1931 by Kurt Tucholsky
Erstmals erschienen 1931
Umschlagbild: Fritz Zuber-Buhler
Junges Mädchen mit Puppe
© Lunata Berlin 2019
Inhalt
Erstes Kapitel Erstes Kapitel
Zweites Kapitel Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Über den Autor
Eine Sommergeschichte
Wir können auch die Trompete blasen
und schmettern weithin durch das Land;
doch schreiten wir lieber in Maientagen,
wenn die Primeln blühn und die Drosseln schlagen,
still sinnend an des Baches Rand.
Storm
Für IA 47 407
1
Ernst Rowohlt Verlag
Berlin W 50
Passauer Straße 8/9
8. Juni
Lieber Herr Tucholsky,
schönen Dank für Ihren Brief vom 2. Juni. Wir haben Ihren Wunsch notiert. Für heute etwas andres.
Wie Sie wissen, habe ich in der letzten Zeit allerhand politische Bücher verlegt, mit denen Sie sich ja hinlänglich beschäftigt haben. Nun möchte ich doch aber wieder einmal die »schöne Literatur« pflegen. Haben Sie gar nichts? Wie wäre es denn mit einer kleinen Liebesgeschichte? Überlegen Sie sich das mal! Das Buch soll nicht teuer werden, und ich drucke Ihnen für den Anfang zehntausend Stück. Die befreundeten Sortimenter sagen mir jedesmal auf meinen Reisen, wie gern die Leute so etwas lesen. Wie ist es damit?
Sie haben bei uns noch 46 RM gut – wohin sollen wir Ihnen die überweisen?
Mit den besten Grüßen
Ihr
(Riesenschnörkel) Ernst Rowohlt
10. Juni
Lieber Herr Rowohlt,
Dank für Ihren Brief vom 8. 6.
Ja, eine Liebesgeschichte ... lieber Meister, wie denken Sie sich das? In der heutigen Zeit Liebe? Lieben Sie? Wer liebt denn heute noch? Dann schon lieber eine kleine Sommergeschichte.
Die Sache jst nicht leicht. Sie wissen, wie sehr es mir widerstrebt, die Öffentlichkeit mit meinem persönlichen Kram zu behelligen – das fällt also fort. Außerdem betrüge ich jede Frau mit meiner Schreibmaschine und erlebe daher nichts Romantisches. Und soll ich mir die Geschichte vielleicht ausdenken? Phantasie haben doch nur die Geschäftsleute, wenn sie nicht zahlen können. Dann fällt ihnen viel ein. Unsereinem...
Schreibe ich den Leuten nicht ihren Wunschtraum (»Die Gräfin raffte ihre Silber-Robe, würdigte den Grafen keines Blickes und fiel die Schloßtreppe hinunter«), dann bleibt nur noch das Propplem über die Ehe als Zimmer-Gymnastik, die »menschliche Einstellung« und all das Zeug, das wir nicht mögen. Woher nehmen und nicht bei Villon stehlen?
Da wir grade von Lyrik sprechen:
Wie kommt es, daß Sie in § 9 unseres Verlagsvertrages 15 % honorarfreie Exemplare berechnen. Soviel Rezensionsexemplare schicken Sie doch niemals in die Welt hinaus! So jagen Sie den sauren Schweiß Ihrer Autoren durch die Gurgel – kein Wunder, daß Sie auf Samt saufen, während unsereiner auf harten Bänken dünnes Bier schluckt. Aber so ist alles.
Daß Sie mir gut sind, wußte ich. Daß Sie mir für 46 RM gut sind, erfreut mein Herz. Bitte wie gewöhnlich an die alte Adresse. Übrigens fahre ich nächste Woche in Urlaub.
Mit vielen schönen Grüßen
Ihr
Tucholsky
Ernst Rowohlt Verlag
Berlin W 50
Passauer Straße 8/9
12. Juni
Lieber Herr Tucholsky,
vielen Dank für Ihren Brief vom 10. d. M.
Die 15 % honorarfreien Exemplare sind – also das können Sie mir wirklich glauben – meine einzige Verdienstmöglichkeit. Lieber Herr Tucholsky, wenn Sie unsere Bilanz sähen, dann wüßten Sie, daß es ein armer Verleger gar nicht leicht hat. Ohne die 15 % könnte ich überhaupt nicht existieren und würde glatt verhungern. Das werden Sie doch nicht wollen.
Die Sommergeschichte sollten Sie sich durch den Kopf gehen lassen.
Die Leute wollen neben der Politik und dem Aktuellen etwas haben, was sie ihrer Freundin schenken können. Sie glauben gar nicht, wie das fehlt. Ich denke an eine kleine Geschichte, nicht zu umfangreich, etwa 15-16 Bogen, zart im Gefühl, kartoniert, leicht ironisch und mit einem bunten Umschlag. Der Inhalt kann so frei sein, wie Sie wollen.
Ich würde Ihnen vielleicht insofern entgegenkommen, daß ich die honorarfreien Exemplare auf 14 % heruntersetze. Wie gefällt Ihnen unser neuer Verlagskatalog? Ich wünsche Ihnen einen vergnügten Urlaub und bin mit vielen Grüßen
Ihr
(Riesenschnörkel) Ernst Rowohlt
15. Juni
Lieber Meister Rowohlt,
auf dem neuen Verlagskatalog hat Sie Gulbransson ganz richtig gezeichnet: still sinnend an des Baches Rand sitzen Sie da und angeln die fetten Fische. Der Köder mit 14 % honorarfreier Exemplare ist nicht fett genug – 12 sind auch ganz schön. Denken Sie mal ein bißchen darüber nach und geben Sie Ihrem harten Verlegerherzen einen Stoß. Bei 14 % fällt mir bestimmt nichts ein – ich dichte erst ab 12 %.
Ich schreibe diesen Brief schon mit einem Fuß in der Bahn. In einer Stunde fahre ich ab – nach Schweden. Ich will in diesem Urlaub überhaupt nicht arbeiten, sondern ich möchte in die Bäume gucken und mich mal richtig ausruhn.
Wenn ich zurückkomme, wollen wir den Fall noch einmal bebrüten. Nun aber schwenke ich meinen Hut, grüße Sie recht herzlich und wünsche Ihnen einen guten Sommer! Und vergessen Sie nicht: 12 %!
Mit vielen schönen Grüßen
Ihr getreuer
Tucholsky
Unterschrieben – zugeklebt – frankiert – es war genau acht Uhr zehn Minuten. Um neun Uhr zwanzig ging der Zug von Berlin nach Kopenhagen. Und nun wollten wir ja wohl die Prinzessin abholen.
2
Sie hatte eine Altstimme und hieß Lydia.
Karlchen und Jakopp aber nannten jede Frau, mit der einer von uns dreien zu tun hatte, »die Prinzessin«, um den betreffenden Prinzgemahl zu ehren – und dies war nun also die Prinzessin; aber keine andre durfte je mehr so genannt werden.
Sie war keine Prinzessin.
Sie war etwas, was alle Schattierungen umfaßt, die nur möglich sind: sie war Sekretärin. Sie war Sekretärin bei einem unförmig dicken Patron; ich hatte ihn einmal gesehn und fand ihn scheußlich, und zwischen ihm und Lydia... nein! Das kommt beinah nur in Romanen vor. Zwischen ihm und Lydia bestand jenes merkwürdige Verhältnis von Zuneigung, nervöser Duldung und Vertrauen auf der einen Seite und Zuneigung, Abneigung und duldender Nervosität auf der andern: sie war seine Sekretärin. Der Mann führte den Titel eines Generalkonsuls und handelte ansonsten mit Seifen. Immer lagen da Pakete im Büro herum, und so hatte der Dicke wenigstens eine Ausrede, wenn seine Hände fettig waren.
Der Generalkonsul hatte ihr in einer Anwandlung fürstlicher Freigebigkeit fünf Wochen Urlaub gewährt; er fuhr nach Abbazia. Gestern abend war er abgefahren – werde ihm der Schlafwagen leicht! Im Büro saßen sein Schwager und für Lydia eine Stellvertreterin. Was gingen mich denn seine Seifen an – Lydia ging mich an.
Da stand sie schon mit den Koffern vor ihrem Haus – »Hallo!«
»Du bischa all do?« sagte die Prinzessin – zur grenzenlosen Verwunderung des Taxichauffeurs, der dieses für Ostchinesisch hielt. Es war aber Missingsch.
Missingsch ist das, was herauskommt, wenn ein Plattdeutscher Hochdeutsch sprechen will. Er krabbelt auf der glatt gebohnerten Treppe der deutschen Grammatik empor und rutscht alle Nase lang wieder in sein geliebtes Platt zurück. Lydia stammte aus Rostock, und sie beherrschte dieses Idiom in der Vollendung. Es ist kein bäurisches Platt – es ist viel feiner. Das Hochdeutsch darin nimmt sich aus wie Hohn und Karikatur; es ist, wie wenn ein Bauer in Frack und Zylinder aufs Feld ginge und so ackerte. Der Zylinder ischa en finen statschen Haut, över wen dor nich mit grot worn is, denn rutscht hei ümmer werrer aff, dat deit he... Und dann ist da im Platt der ganze Humor dieser Norddeutschen; ihr gutmütiger Spott, wenn es einer gar zu toll treibt, ihr fest zupackender Spaß, wenn sie falschen Glanz wittern, und sie wittern ihn, unfehlbar ... diese Sprache konnte Lydia bei Gelegenheit sprechen. Hier war eine Gelegenheit.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Schloss Gripsholm»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Schloss Gripsholm» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Schloss Gripsholm» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.