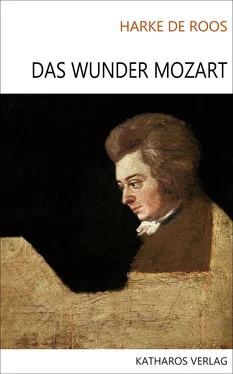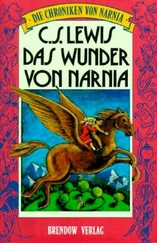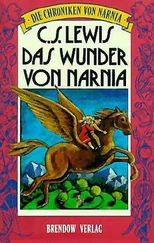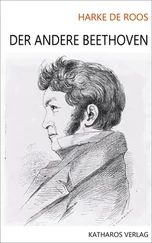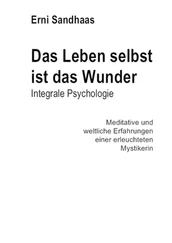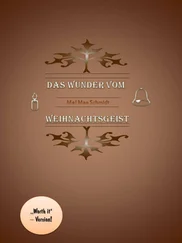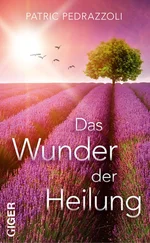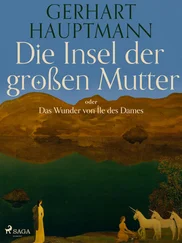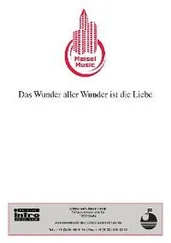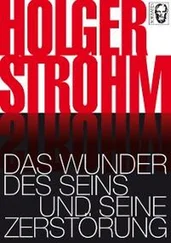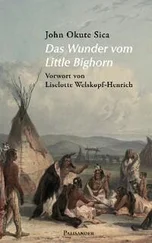In dieser Situation kam Marie Christine, wie wir aus den Memoiren der hofnahen Karoline Pichler entnehmen, auf die unselige Idee, ihren Bruder über die sexuelle Veranlagung seiner gestorbenen Frau aufzuklären und ihm als Beweis die an sie geschriebenen Liebesbriefe Isabellas vorzulegen (ihre eigenen an Isabella waren ohnehin schon von Joseph konfisziert worden). Vielleicht wollte sie Joseph wieder auf die Erde zurückbringen und insbesondere den Glanz seiner verstorbenen Abgöttin mindern, aber es ist ebenso gut möglich, dass sie sich an ihrem ehemaligen Nebenbuhler rächen wollte. Sehr zimperlich sind die habsburgischen Geschwister nicht mit einander umgegangen.
Die Folgen ihrer Aufklärungstat waren verheerend. Äußerlich gesehen schien Marie Christine ihr Ziel erreicht zu haben. Tatsächlich kehrte Josephs Vitalität zurück. Neues Leben fuhr ihm in die Glieder, aber was für eins! Sein Inneres glich fortan einem Trümmerhaufen, seine ethisch-moralischen Vorstellungen waren zerbrochen und von der Liebesfähigkeit, mit der er einst so reichlich gesegnet war, blieb nichts als eine Quelle verdorbenen Wassers. Eine so große Liebe wie Josephs Liebe für Isabella hört nicht plötzlich auf. Sie bleibt erhalten, wenn auch im Verborgenen und in abgewandelter Form.
Joseph wehrte sich gegen seine Schmerzen, indem er sie an andere weiterzuleiten versuchte. Vor allem Frauen mussten es entgelten, denn sie hatten ihm schließlich die immer währende Wunde zugefügt. Seine Zerstörungswut richtete sich aber indirekt auch gegen das eigene Geschlecht, nicht zuletzt gegen solche frauenfreundlichen Männer wie Bruder Leopold oder einen gewissen Musiker namens Mozart. Im Grunde waren alle Menschen seine Feinde, wie aus den Aufzeichnungen seines Bruders Leopold eindeutig hervorgeht. Nur für seinen jüngsten Bruder Max empfand er eine fast zärtliche Zuneigung, vielleicht weil dieser sich aufgrund seiner Verletzung jenseits aller Geschlechterkämpfe befand.
Josephs Rachefeldzug gegen die Frauen und ihre Freunde trug die Merkmale einer antiken Tragödie. Mit innerer Folgerichtigkeit wurde der Kaiser und mit ihm sein ganzes Reich langsam, aber unaufhörlich an den Rand des Abgrunds getrieben. Auf tragische Weise verband sich private Misere mit dem Wohl des Staates, transformierte sich das Chaos im Gemüt zum Chaos der öffentlichen Angelegenheiten. Am Ende dieses Prozesses, als Joseph starb, war die ganze Bevölkerung der Donaumonarchie gegen ihn aufgebracht. In Ungarn und den österreichischen Niederlanden war offener Aufruhr ausgebrochen und auch in Böhmen kochte Unmut. Die Substanz des Reiches war in höchster Gefahr. Hinzu kamen noch die äußeren Feinde. Der Angriff Preußens auf Österreich stand unmittelbar bevor und galt bereits als unabwendbar. Preußen hatte sich zum drohenden Krieg mit Polen verbunden; die Polen ihrerseits unterstützten den Aufstand Ungarns gegen Wien. Der Türkenkrieg war noch nicht beendet und auch mit Bayern gab es gefährliche Spannungen.
In Frankreich griff die Revolution immer weiter um sich und drohte auf andere Länder, sogar auf Italien, überzuspringen. Schon standen gebietshungrige Staaten wie Spanien und Parma in den Startlöchern, um im zu erwartenden Krieg Preußens gegen Österreich große Teile des Vielvölkerstaates und dessen Verbündeter zu schlucken. Spanien wollte sich das Königreich Neapel-Sizilien einverleiben, Parma die Toskana. Die Lage war so dramatisch, dass selbst Josephs treuester Diener, Reichskanzler Kaunitz, das Sterben seines Herrn mit der Bemerkung kommentierte: „Es war das beste, was er tun konnte“.
Ein höchst eigentümlicher Zug an Josephs Amoklauf war, dass er sich im Verborgenen abspielte. Der Kaiser gab sich nach außen hin als Gegenteil eines verbitterten Misanthropen. Zwar galt er als knauserig, aber er war zugleich witzig und zuvorkommend; er konnte unerhört charmant sein. Die ersten fünf Jahre seiner Alleinherrschaft sind durch Aufgeschlossenheit, Liberalität und eine nie vorher erlebte Toleranz gekennzeichnet. Für den epochalen Höhenflug der abendländischen Musik, die gerade zu diesem Zeitpunkt einen Kulminationspunkt erreicht hatte, waren diese Eigenschaften von grundlegender Bedeutung.
Joseph war es, der die unverwechselbare Atmosphäre des Goldenen Jahrzehnts geschaffen hatte, diese Wiener Mischung von Vornehmheit und Volkstümlichkeit, höchster Verfeinerung und triebhafter Natur, Maskerade und Spontaneität. Wo immer er erschien, und oft kam er verkleidet, riss er alle Fäden an sich und hinterließ einen Sog erlebter Energie. Es war wahrhaftig ein Röntgenblick vonnöten, um die extrem sinnliche, ja, im wahrsten Sinne des Wortes übersinnliche Anarchie hinter dem irreführenden Auftreten dieses Mannes zu erkennen. Später werden wir aber sehen, dass es diese Augen tatsächlich gab und dass der Reformkaiser von keinem besser durchschaut worden ist als von Mozart.
Kurze Zeit, nachdem Joseph zum Römischen Kaiser gekrönt worden war, zwang ihn seine Mutter, noch einmal in den Ehestand zu treten. Maria Theresia, die eine dauerhafte Allianz mit dem reichen Bayern anstrebte, verkuppelte ihren trauernden Sohn mit einer Prinzessin aus dem Hause Wittelsbach, Josefa von Bayern. Bereits im Januar 1765 fand die Hochzeit statt, aber diesmal hatte die Kaiserin sich in ihrer sonst so erfolgreichen Heiratspolitik verrechnet. Ihre neue Schwiegertochter wurde von Joseph so feindselig behandelt, dass die Beziehungen zwischen Österreich und Bayern darunter zu leiden hatten.
Um sich an der Mutter, aber auf verschlungenem Wege sicherlich auch an der Schwester Marie Christine zu rächen, mied Joseph Josefa, wo er nur konnte, schimpfte über ihr Aussehen und ließ sogar Vorkehrungen treffen, damit ihm in seinen privaten Räumen ihr Anblick erspart blieb. Für die gutmütige junge Frau bedeutete diese Art von Zurückweisung eine Hölle. Bereits zwei Jahre später, am 28. Mai 1767, starb sie, offiziell an den Blattern, inoffiziell vor lauter Kummer.
In den nun folgenden dreizehn Jahren bis zum Tod der Mutter 1780 lebte Joseph in einem Frauenhaushalt. Der Vater war bereits 1765 gestorben und Maria Theresia, die ihren Sohn zum Mitregenten ernannt hatte, aber alle Macht im Staate für sich beanspruchte, umgab sich gerne mit ihren Töchtern. In dieser Periode entwickelte sich Joseph, wohl aus Frust, zu einem der schlimmsten Fraueneroberer.
Wohl verstanden: alle hohen Herren waren in der Regel unermüdliche Schürzenjäger. Auch Josephs Vater Franz Stephan jagte nicht nur Hirsche und Hasen, Staatskanzler Kaunitz liierte sich gerne mit schönen Sängerinnen, Reichsvizekanzler Colloredo-Waldsee galt ebenso als hemmungsloser Schürzenjäger wie Josephs Schwager Ferdinand in Neapel, ganz zu schweigen von historischen Exempeln wie August dem Starken oder Frankreichs Sonnenkönig Ludwig XIV. In Josephs Kreisen war die Promiskuität so gut wie legalisiert, sogar aus der Sicht der Kirche. Schließlich gehörte das „Recht auf die erste Nacht“ zum Unterdrückungsmechanismus der herrschenden Klasse, indem es sich gleichermaßen gegen die weiblichen wie gegen die männlichen Untertanen richtete. Zudem gab es unter den Zeitgenossen Josephs epochale Frauenhelden wie Casanova oder Beaumarchais.
Bei Joseph treffen wir jedoch auf einen Aspekt, der bei allen anderen Vertretern seiner Spezies fehlt: die Abrechnung. Andere Schürzenjäger suchten das Liebesabenteuer, weil sie die Frauen liebten, Joseph brüstete sich dagegen damit, als Frauenhasser zu gelten. Ganz offensichtlich suchte er die körperliche Vereinigung mit dem anderen Geschlecht nicht, weil er sich in Frauen verliebte, sondern um sie zu erniedrigen, zu bestrafen oder zu besiegen. Dabei ging er äußerst gründlich vor: seine eigene Schwester Maria Karoline berichtet, dass es in Wien keine einzige Frau gab, mit der der Kaiser nicht geschlafen hätte. Für unsere Geschichte ist diese Aussage von Relevanz, denn es würde bedeuten, dass auch die Töchter eines gewissen Fridolin Weber, Aloysia und Konstanze, zur Beute Josephs gerechnet werden müssen.
Читать дальше