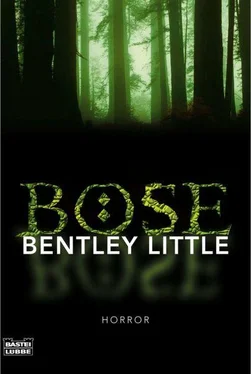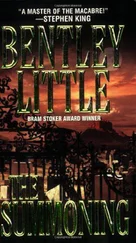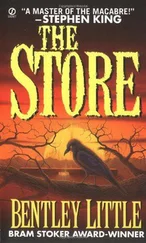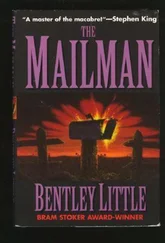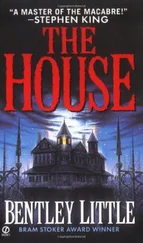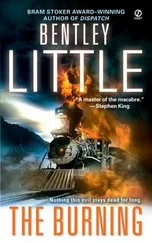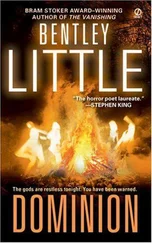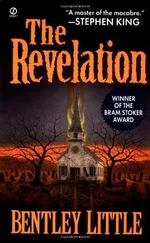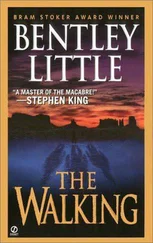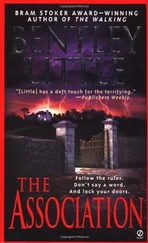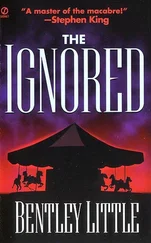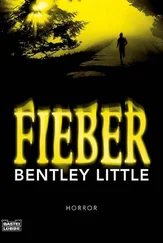»Hier sind keine Wanzen«, sagte Doug. »Unsere Polizei kann sich keine leisten.«
»Und selbst wenn dort welche wären«, ergänzte Stevens, »wären Beweise, die durch ihren Gebrauch gesammelt wurden, vor Gericht nicht zulässig.«
»Das ist dein Anwalt«, sagte Doug. »Yard Stevens.«
Der Anwalt streckte Hobie eine dicke, rosafarbene Hand entgegen. »Wie geht es Ihnen?«
»Was glauben Sie? Ich sitze wegen Mordes im Gefängnis.«
»Haben Sie es getan?«
»Zum Teufel, nein.«
Doug fühlte sich etwas besser. Hobie sah immer noch schrecklich aus, doch der Schock und die Verwirrtheit der letzten Nacht schienen verschwunden zu sein. Er wirkte nun zuversichtlicher, wieder mehr wie der raubeinige Typ, der er sonst war.
»Doug?« Stevens wandte sich ihm zu. »Ich würde gerne mit meinem Mandanten allein sprechen. Vielleicht brauche ich Ihre Zeugenaussage vor Gericht, und ich möchte deren Rechtsgültigkeit nicht gefährden, indem ich Ihnen Zugang zu vertraulichen Informationen verschaffe.«
Doug nickte. »Okay. Ich warte draußen.«
»Gut.«
»Danke«, sagte Hobie.
»Ich komme dich später besuchen.« Doug klopfte an die geschlossene Tür, die von außen geöffnet wurde, und ging über den Flur zum vorderen Büroraum, als er hinter sich eine vertraute Stimme hörte. »Mr. Albin? Könnte ich Sie mal kurz sprechen?«
Er drehte sich um und sah Mike Trenton, der ihm von der Tür eines Büros aus ein Zeichen machte.
»Doug. Ich hatte Ihnen gesagt, dass Sie mich Doug nennen können.«
Er folgte Mike in ein kleines Zimmer, das von einem riesigen Tisch beherrscht wurde. Zwei Wände waren vom Boden bis zur Decke mit Lehrbüchern und gebundenen Fallstudien bedeckt. »Das war mal die Polizeibibliothek«, erklärte Mike, der Dougs Blick bemerkt hatte. »Na ja, eigentlich ist sie es immer noch, aber jetzt ist sie auch mein Büro.«
»Worüber wollten Sie mit mir sprechen?«
»Über Mister Beecham.«
»Ich dachte, Sie wären aus allen Postbotenfällen raus.«
Mike zuckte mit den Schultern. »Willis hat ein kleines Polizeirevier. Und hier ist eine Menge passiert. Wir sind knapp an Personal. Außerdem ist es kein ›Postbotenfall‹.«
»Doch, das ist es, und Sie wissen das.«
»Ich wollte Ihnen nur ein paar Fragen zu Mister Beecham stellen.«
Doug erhob sich und ging auf und ab. »Ach, kommen Sie, Mike. Sie wissen verdammt gut, dass Hobie das Mädchen nicht getötet hat.«
»Ich weiß gar nichts. Ich würde Ihnen gerne helfen, wirklich, aber Mister Beechams Fingerabdrücke - blutige Abdrücke, sollte ich hinzufügen - wurden auf der Mordwaffe und überall im Raum gefunden. Und diese Fotos an der Wand ...« Er schüttelte den Kopf. »Sie beweisen gar nichts, sind aber auf jeden Fall ein Indiz für ein krankes Hirn ...«
»Diese Fotos wurden Hobie Beecham von seinem Bruder geschickt.«
»Von seinem toten Bruder?«
»Was ist los mit Ihnen, Mike? Was ist passiert? Vor einer Woche standen Sie der Sache noch offen gegenüber, und jetzt ...« Doug suchte nach den richtigen Worten.
»Jetzt stelle ich mich den Fakten«, beendete der Polizist den Satz für ihn.
»Nein, jetzt verstecken Sie sich«, entgegnete Doug. »Sie greifen nach jeder Antwort, die in Ihre Polizeilogik passt, die kategorisiert und katalogisiert und in einer Akte abgelegt und vergessen werden kann. Ich weiß, dass Sie Angst haben. Zum Teufel, wir alle haben Angst. Aber Sie suchen eine logische Erklärung, und die werden Sie nicht finden. Sie würden gern glauben, dass wir verrückt sind, dass das alles gar nicht passiert, dass das Leben normal weitergeht. Aber es wird nicht normal weitergehen. Hier sterben Menschen, Mike. Vielleicht wollen Sie es sich nicht eingestehen, aber jeder weiß es - Ich weiß es, Sie wissen es, jeder in der Stadt weiß es. Es sterben Menschen wegen dieses verdammten Postboten. Nennen Sie es übernatürlich, nennen Sie es, wie Sie wollen, aber es passiert wirklich.«
»Hobie Beechams Fingerabdrücke waren auf den Messern«, wiederholte Mike müde.
»Nehmen Sie mich ernst, Mike. Reden wir auf Augenhöhe miteinander. Verschonen Sie mich mit diesem offiziellen Gefasel.«
»Es ist ein glasklarer Fall ...«
»Ach, hören Sie auf. Ich bin nicht Ihr Feind, Mike. Himmel, wenn wir alle nur ein bisschen mehr Zeit dafür verwenden würden, zusammenzuarbeiten, würden wir viel mehr erreichen.«
Der Polizist lächelte leicht. »Sie waren immer ein guter Redner. Deshalb waren Sie auch einer meiner Lieblingslehrer.«
»Ich rede hier nicht nur so herum.«
»Wir haben Beweise, Mister Albin. Hobies Fingerabdrücke sind auf den Messern. Unter seinen Fingernägeln wurde Blut gefunden, auf seiner Kleidung, in seinem Haar.«
Doug öffnete die Tür. »Fein«, sagte er und wies mit dem Zeigefinger anklagend auf den jungen Polizisten. »Halten Sie sich an Ihre Vorschriften, stecken Sie den Kopf in den Sand. Aber der nächste Kopf, auf den gezielt wird, ist Ihrer. Sie hätten etwas dagegen tun können. Sie wollen mit mir über Hobie reden? Dann besorgen Sie sich eine Vorladung.« Doug schlug die Tür hinter sich zu und verließ das Polizeirevier. Als er im Freien stand, atmete er tief durch und versuchte, sich zu beruhigen. Die warme Morgenluft füllte seine Lunge; sie schmeckte sauber und frisch und erinnerte ihn an glücklichere Sommer. Doug ließ den Blick über den kleinen Parkplatz schweifen und entdeckte den glänzenden Briefkasten aus Metall, der auf einem Pfahl neben dem niedrigen Lattenzaun stand, dort, wo der Parkplatz an die Straße grenzte. Das Sonnenlicht wurde von der gebogenen Oberseite des Kastens reflektiert.
Er hasste diese verdammten Aluminiumdinger.
Er ging zum Wagen und wartete auf Stevens.
»Lass mich rein! Lass mich rein, verdammt noch mal!« Trish stand auf Irenes Veranda. Abwechselnd klingelte sie und hämmerte gegen die Tür. Sie wusste, dass die alte Frau zu Hause war: Der Wagen stand in der Auffahrt, und hinter den großen Vorhängen hatte Trish Bewegung gesehen. Irene wollte einfach nicht mit ihr reden.
Das kühlere Wetter der vergangenen Tage war vorbei, und die heiße Nachmittagssonne knallte auf ihre Schultern. Trish schwitzte und starb beinahe vor Durst. Das brachte sie auf eine andere Idee. »Lass mich nur für einen Moment rein, Irene«, rief sie durch die geschlossene Eingangstür. »Ich möchte bloß ein Glas Eistee, dann bist du mich endgültig los.«
Sie wartete einen Augenblick. Nichts tat sich. Sie wollte gerade wieder gegen die Tür hämmern, als sie das metallische Klirren der Kette hörte, die innen geöffnet wurde, und das Geräusch des Riegels, den jemand zurückschob. Langsam wurde die Tür geöffnet.
Trish erschrak. Sie erkannte ihre Freundin kaum wieder. Irene schien geschrumpft zu sein und wenigstens fünf Kilo abgenommen zu haben. Sie war nie eine große Frau gewesen, aber jetzt erschien sie noch kleiner. Ihr dünnes, drahtiges Haar war ungekämmt und stand in zerzausten Strähnen von ihrem Kopf ab. Ihr Gesicht wirkte erschreckend hager, und sie trug einen schmuddeligen Pyjama. Anklagend starrte sie Trish an. »Ich habe dir doch gesagt, du sollst es keinem erzählen.«
»Tut mir leid«, entschuldigte sich Trish. »Aber ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ich wusste, was vor sich ging, und wollte dir helfen ...«
»Du hast es nur schlimmer gemacht«, entgegnete die alte Frau. Plötzlich zuckte sie mit einem Schreckensschrei zusammen, wirbelte herum und blickte hinter sich, als suchte sie jemanden. Doch da war niemand. Nervös und mit gehetztem Blick drehte sie sich wieder zu Trish um. »Lass mich in Ruhe«, sagte sie. »Bitte.«
»Ich bin deine Freundin«, sagte Trish. »Ich mache mir Sorgen.«
Irene schloss die Augen und seufzte. Dann trat sie zur Seite und öffnete die Tür ganz. Trish betrat das Haus. Es herrschte ein wüstes Durcheinander. Schranktüren standen offen, der Inhalt lag mitten im Wohnzimmer auf einem Haufen, umgekippte Pappschachteln stapelten sich auf dem Orientteppich. Durch den Durchgang zur Küche waren zerbrochene Gläser zu sehen. Irene, deren Wangen eingesunken waren und deren starre Augen tief in den Höhlen lagen, wich rasch von der Tür zurück und knetete nervös ihre Hände.
Читать дальше