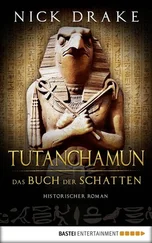Die bloße Vorstellung ließ Ludlow verächtlich schnauben. »Meine Eltern kümmern sich doch nicht um Geschriebenes! Und um mich erst recht nicht. Mr Lembart Jellico hat’s mir beigebracht, ein Pfandleiher in der Stadt.«
»Lembart Jellico?«, wiederholte Joe. »Wie interessant.«
»Kennt Ihr ihn etwa?«, fragte Ludlow, aber Joe suchte schon nach einem neuen Blatt Papier.
»Schreib«, sagte er und diktierte Ludlow ein paar Sätze. Der Junge schrieb sie sorgfältig nieder, bevor er Joe das Blatt zur Korrektur zurückgab.
»Zabbidou mit zwei b«, brummte Joe, »aber das konntest du ja nicht wissen.«
Er trat zurück und musterte den Jungen mit einem langen Blick. Er glich so vielen anderen Stadtjungen, schmutzig und mager. Ganz sicher aber roch er wie einer. Seine Kleider erfüllten kaum mehr ihren Zweck (abgesehen von dem Halstuch und den Handschuhen, die von viel besserer Qualität waren), und der misstrauische Gesichtsausdruck ließ das Elend seines bisherigen Daseins ahnen. Überall hatte er blaue Flecken und sein Mund war geschwollen, aber in seinen dunklen Augen blitzte Intelligenz auf – und noch etwas anderes.
»Wenn du willst, ich hätte Arbeit für dich.«
Ludlows Augen wurden schmal. »Gibt’s was zu verdienen?«
Joe gähnte. »Lass uns morgen darüber sprechen. Es ist Zeit zum Schlafen.«
Er warf Ludlow seinen warmen Umhang zu, und der Junge rollte sich in der Nische neben dem Kamin zusammen. Noch nie hatte er einen so weichen Pelz gefühlt, er wickelte sich fast wie von selbst um seine Beine. Durch halb geschlossene Augen beobachtete Ludlow, wie Joe sich auf dem Bett gegenüber niederließ, und hörte ihn schon schnarchen, bevor seine Beine ganz ausgestreckt waren. Als Ludlow sicher war, dass Joe fest schlief, zog er den Geldbeutel hervor, den er in der Kutsche gestohlen hatte, und versteckte ihn hinter einem losen Mauerstein in der Wand. Dann nahm er das Papier und las noch einmal, was er geschrieben hatte:
Mein Name ist Joe Zabbidou. Ich bin der Geheimnis-Pfandleiher.
Geheimnis-Pfandleiher?, dachte Ludlow. Was mochte das für ein Beruf sein? Aber lange dachte er nicht darüber nach, denn bald schlief er ein und träumte wilde Dinge, die sein Herz rasen ließen.
Kapitel 5

Fragment aus den
Erinnerungen des Ludlow Fitch
Eigentlich hatte ich Joe gar nicht erzählen wollen, dass ich ein Taschendieb war, keine Ahnung, warum ich ihm die Wahrheit verraten habe. Was Pfandleiher angeht, so wusste ich natürlich Bescheid über sie und ihr Gewerbe. Oft genug bin ich in ihren Läden ein und aus gegangen, als ich noch in der Stadt lebte. Was Ma und Pa zusammenklauten und selber nicht brauchen konnten, versetzten sie bei Pfandleihern. Oder sie schickten mich hin. Pfandleihhäuser gab es so ziemlich an jeder Ecke und sie hatten zu jeder Zeit geöffnet. Nach dem Wochenende, wenn alle ihren Lohn in Bier umgesetzt oder das Geld beim Kartenspielen verloren hatten, war dort am meisten los. An Montagvormittagen, das könnt ihr mir glauben, bot das Schaufenster eines Pfandleihhauses einen sehenswerten Anblick. Alles Mögliche hatten die Leute angeschleppt: Hemden, alte Schuhe, Pfeifen, Geschirr – alles, was vielleicht einen halben Penny einbringen könnte.
Der Pfandleiher nahm aber längst nicht alles. Er zahlte auch nicht viel, doch wenn sich jemand beschwerte, sagte er nur: »Ich bin kein Wohltätigkeitsverein. Entweder du gehst drauf ein oder du lässt’s bleiben.«
Und gewöhnlich nahmen sie sein Angebot an, weil ihnen nichts anderes übrig blieb. Was man verpfändet hatte, konnte man natürlich jederzeit zurückkaufen, aber dann musste man mehr dafür hinlegen, als man bekommen hatte. Auf diese Weise verdiente ein Pfandleiher seinen Lebensunterhalt – er bereicherte sich auf Kosten der Armen.
Lembart Jellico aber war nicht so wie die anderen. Das sah man schon daran, dass sein Laden in einem versteckten Seitengässchen der Pledge Street lag. Finden konnte ihn nur, wer ihn schon kannte, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich selbst hatte ihn zufällig gefunden, als ich wieder einmal auf der Suche nach einem Versteck vor Ma und Pa gewesen war. Die Einmündung des Seitengässchens war so schmal, dass ich mich seitwärts hineinschieben musste. Wenn man emporschaut, kann man dort nur ein Stückchen des verqualmten Stadthimmels sehen. Mr Jellicos Laden war am Ende des Gässchens, und zuerst dachte ich, er sei geschlossen, doch als ich meine Nase gegen die Tür drückte, gab sie nach. Der Pfandleiher stand hinter seinem Ladentisch, aber er sah mich nicht. Er schaute vor sich hin, als träumte er am helllichten Tag.
Ich hustete.
»Entschuldige«, sagte der Mann blinzelnd. »Wie kann ich dir helfen, mein Junge?« Das waren die ersten freundlichen Worte, die ich an diesem Tag hörte. Ich gab ihm, was ich hatte: einen Ring, den ich einer Dame vom Finger gestreift hatte. (Es war eine meiner besonderen Fähigkeiten, einen unseligen Passanten mit meinem traurigen Blick zu betören und ihn zugleich von der Last seiner Juwelen zu befreien.) Mr Jellicos Augenbrauen hoben sich, als er das Schmuckstück sah.
»Er gehört wohl deiner Mutter?«, sagte er, drängte aber nicht auf eine Antwort.
Mr Jellico sah genauso arm aus wie seine Kunden. Er trug Sachen, die nie zurückgekauft worden waren (und die auch sonst keiner haben wollte). Seine Haut war bleich, weil er nie an die Sonne kam, und sie glänzte ein wenig wie feuchter Teig. Seine langen Fingernägel waren meistens schwarz, und auf seinem zerfurchten Gesicht sprossen graue Stoppeln. Immer hing ein Tropfen an seiner Nasenspitze, und ab und zu wischte er ihn mit dem roten Taschentuch weg, das in seiner Westentasche steckte. Für den Ring gab er mir damals einen Shilling, und so brachte ich ihm am nächsten Tag mehr von meiner Beute und bekam einen zweiten Shilling. Danach ging ich so oft wie möglich zu ihm.
Ich weiß nicht, ob Mr Jellico überhaupt etwas verdiente. In seinen Laden verirrte sich kaum je ein Kunde, das Schaufenster war schmutzig und nie gab es viel darin zu sehen. Einmal lag ein Laib Brot auf dem Regal.
»Ein junges Mädchen«, sagte Mr Jellico, als ich ihn danach fragte. »Hat das Brot gegen einen Topf getauscht, damit sie Schinken darin auskochen kann. Morgen wird sie den Topf zurückbringen und ihr Brot dafür wieder mitnehmen – vielleicht ein bisschen härter, aber im Wasser lässt es sich wohl wieder aufweichen.«
Was für eine merkwürdige Abmachung zwischen Pfandleiher und Kunde!
Ich weiß nicht, warum Mr Jellico so freundlich zu mir war, warum er – bei den Heerscharen anderer Jungen, die durch die gefährlichen Straßen zogen – ausgerechnet mir sein Mitgefühl schenkte. Was immer der Grund war, ich hatte nichts dagegen. Ich erzählte ihm von Ma und Pa, wie sie mich behandelten, wie wenig ich ihnen bedeutete.
Manchmal, wenn es zu kalt war, um sich draußen aufzuhalten, und ich Angst vor dem Nach-Hause-Kommen hatte, durfte ich mich an seinem Feuer aufwärmen und er gab mir Tee und Brot. Er brachte mir das Alphabet und die Zahlen bei und ließ mich auf den Rückseiten alter Fahrkarten das Schreiben üben. Er zeigte mir Bücher, und ich musste Seite um Seite daraus abschreiben, bis er mit meiner Handschrift zufrieden war. Man hat mir gesagt, meine Ausdrucksweise sei ein wenig steif und formell. Aber das liegt an den Texten, nach denen ich gelernt habe. Es ging darin immer um ernste Dinge, um Kriege, um Ereignisse aus der Geschichte und um die Schriften großer Denker. Da war für Humor wenig Platz.
Als Gegenleistung für seinen Unterricht erledigte ich mancherlei für Mr Jellico. Am Anfang schrieb ich die Preisschilder für das Schaufenster, und als meine Schrift allmählich besser wurde, ließ er mich die verpfändeten Sachen samt den Beträgen in sein Geschäftsbuch eintragen. Von Zeit zu Zeit ging die Tür auf und es kam ein Kunde. Mr Jellico unterhielt sich gern und verwickelte die Leute eine ganze Weile in Gespräche, bevor er ihre Sachen annahm und bezahlte.
Читать дальше