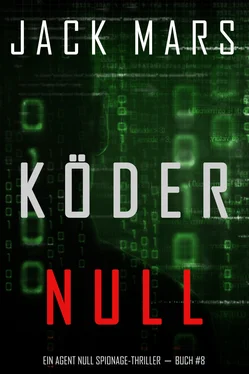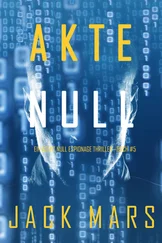Sara erstarrte. Sie hatte wortwörtlich einen Fuß noch in der Luft und reckte ihren Hals in Richtung Tür.
„Aber wie ihr euch vorstellen könnt“, sagte eine Frau ernst aus dem Inneren, „hatte meine Abhängigkeit etwas anderes im Sinn. Eines Tages ging es mir richtig schlecht, da hielt ich es nicht mehr aus. Ich kannte einen Typen in der Nachbarschaft. Ich rief ihn an.“
An der Tür hing ein Schild. Es war ein einfaches Blatt weißes Papier mit einigen Worten, die in schwarzer Tinte darauf geschrieben standen. Mit Klebeband war es an der Tür befestigt.
Zusammengehörigkeit
Trauma teilen, Hoffnung teilen
„Es waren nur ein paar Minuten.“ Die Frau drinnen sprach leiser, fast so leise, dass Sara sie nicht mehr hören konnte. Sie drückte die Tür sanft auf, nur ein paar Zentimeter weiter. „Ich ließ meinen zweijährigen Sohn allein in der Wohnung, doch es waren nur ein paar Minuten.“ Im Zimmer konnte Sara Frauen sehen, die sich in einem Halbkreis gegenübersaßen. Ihre Gesichtsausdrücke waren ernst und traurig.
„Doch während dieser paar Minuten entschied sich mein Ex-Freund - der Vater meines Babys - vorbeizuschauen.“ Die Frau starrte auf den Boden, während sie sprach. Ihre Haut war blass und sie trug kein Makeup. Ihr braunes Haar hatte sie hastig zu einem einfachen Zopf gebunden. „Ich kam mit einem Tütchen Drogen in der Hand zurück und sah meinen Sohn in seinen Armen. Das war der Tag, an dem ich ihn verlor…“
Plötzlich erschien ein Gesicht in der halb geöffneten Tür. Sara erschreckte sich und sprang zurück. Die Frau lächelte ihr zu. Sie sah gleichzeitig jung und doch matronenhaft aus, wie eine Fußballmama aus der Vorstadt, welche die Freunde ihrer Kinder einlädt, zum Abendessen zu bleiben und Nein nicht als Antwort gelten lässt.
„Hallo“, sagte die Frau leise, um nicht das Treffen hinter ihr zu unterbrechen. „Bist du für Zusammengehörigkeit hier?“
„Ich, äh…“ Sara räusperte sich und schüttelte schnell den Kopf. „Nein. Das bin ich nicht. Ich spähte nur hinein. Tut mir leid.“
„Schon in Ordnung.“ Die Frau ging in den Gang hinaus und schloss sanft die Tür hinter sich. „Wir sind eine Selbsthilfegruppe für Frauen, die verschiedene Arten von Trauma erlebt haben. Drogenabhängigkeit, häusliche Gewalt, posttraumatische Belastungsstörung, Depressionen… Wir erzählen einander unsere Erlebnisse und durch die anderen finden wir -“
„Zusammengehörigkeit“, murmelte Sara. „Ja, ich verstehe.“
Die Frau lächelte. „Super.“ Dann tat sie etwas seltsames - sie blickte Sara direkt in die Augen. Sie runzelte zwar die Stirn, als wäre sie verärgert, doch das Lächeln verließ nie ihre Lippen. Sara gefiel der Blick gar nicht. Es kam ihr vor, als ob die Frau in ihr… lesen würde.
„Bist du dir sicher, dass du nicht hereinkommen möchtest? Du kannst dich einfach setzen und zuhören. Du musst nichts sagen.“
„Nein. Danke. Ist schon… in Ordnung.“ Sara ging noch einen Schritt zurück. „Ich wollte eigentlich gerade gehen.“ Ihr ging es auch ohne Rehabilitation gut, sie brauchte ganz bestimmt keine „Selbsthilfegruppe“.
Sie drehte sich um, doch die Frau redete weiter. „Ich heiße übrigens Maddie.“
„Sara“, rief sie über ihre Schulter.
„Schön, dich kennenzulernen. Wir sehen uns noch, Sara.“
Das werden wir nicht. Sara eilte den Gang entlang. Plötzlich fand sie das kalte Februarwetter in Maryland gar nicht mehr so schlimm.
Maya starrte das Handy in ihrer Hand an. Der Anrufspeicher war offen, die Nummer stand direkt da. Sie musste sie nur antippen.
Vielleicht morgen.
Sie saß im Schneidersitz auf ihrem Doppelbett, das in der gegenüberliegenden Ecke von Saras Bett stand. Zwischen den beiden war etwa ein Meter Platz. Ihre Unterkunft war zwar etwas eng - doch gar nicht so unähnlich den Kasernen, an die sie sich in West Point gewöhnt hatte. Sara hatte in Jacksonville vier Mitbewohner gehabt, also war ihr Wohnarrangement für beide kein Problem. Mehr als einmal hatten sie das Angebot ihres Vaters, in das größere Schlafzimmer der Wohnung umzuziehen, abgelehnt.
Maya warf das Handy auf die Zudecke neben das Buch Ulysses , das sie größtenteils ignorierte (ihr Vater nannte es einen „Triumph in Masochismus“), und einen angebissenen Proteinriegel. Sie wollte einfach anrufen. Das täte sie auch. Aber nicht heute.
Die Nummer, die sie sich nicht traute zu wählen, würde sie mit dem Büro der Dekanin von West Point, Brigadier-General Joanne Hunt, verbinden. In den letzten Wochen hatte Dekanin Hunts Büro Maya vier Mal angerufen. Sie hatten allerdings keine Mailbox-Nachrichten oder sonstigen Anzeichen für den Grund ihrer Anrufe hinterlassen.
Das brauchten sie auch nicht, Maya wusste warum. Nach dem fürchterlichen Erlebnis in einem Umkleideraum für Mädchen, in dem es zu einer Auseinandersetzung mit drei Jungs gekommen war, von denen Maya zwei schwer zusammengeschlagen und den dritten fast umgebracht hatte, hatte ihr Dekanin Hunt netterweise angeboten, den Rest des Herbstsemesters auszusetzen, damit sie im Januar nach den Winterferien wieder zurückkommen konnte.
Doch Maya war nicht zurückgekehrt und jetzt war es zu spät dafür. Sie hatte zu viel verpasst. Sie hatte ihre Ausbildung um mindestens sechs Monate unnötigerweise verlängert - das war ein gewaltiger Schlag, wo es doch ihr Ziel war, die jüngste CIA-Agentin in der Geschichte der Agentur zu werden.
Doch sie brauchte nicht nur Zeit. Das war es, was sie ihrem Vater und ihrer Schwester erzählt hatte. Einfach nur ein wenig mehr Zeit mit ihnen und für sich, dann ginge sie zurück. Doch sie wusste nur zu gut, dass jeder Tag, den sie verstreichen ließ, ohne anzurufen und zu versprechen, im nächsten Semester zurückzukehren, ein weiterer Tag war, an dem sie sich überlegen konnte, überhaupt nicht mehr zurückzukehren.
Die Eingangstür der Wohnung öffnete sich und Maya schreckte kurz zusammen. Das war eine ganz natürliche Reaktion, wenn man bedachte, wie oft schon jemand in ihr Zuhause eingebrochen war, um ihre Familie zu töten oder zu entführen. Doch sie hatte gelernt, die Schritte ihres Vaters zu erkennen; sein frustriertes Seufzen, wenn die Tür ein wenig hängenblieb, weil sie sich wegen der Kälte verzogen hatte. Maya atmete auf.
„Liebes, ich bin zu Hause!“ rief er.
„Wer ist denn ,Liebes‘?“ wollte Maya lächelnd wissen.
„Wer immer auf ,Liebes‘ antwortet, schätze ich.“
„Ich bin allein hier.“
Er erschien in der Tür und grinste. „Na, in dem Fall: Hallo Liebes. Wo ist deine Schwester?“
„Kunstunterricht im Gemeindezentrum.“
„Stimmt. Ich hatte vergessen, dass sie dahingeht. Aber ich freue mich darüber. Soll ich sie abholen?“
„Ist mit dem Rad gefahren.“
Ihr Vater blinzelte unverständig. „Im Februar?“
„Sie sagte, dass sie die Kälte mag. Hält sie munter.“
„Sowas. Und mich nennt sie komisch.“
Maya rutschte vom Bett und folgte ihm in die Küche, wo er im Kühlschrank herumkramte und ein Light-Bier herauszog. Nachdem er den Kronkorken abgedreht hatte, fuhr er sich mit einer Hand durch sein Haar und seufzte, bevor er den ersten Schluck nahm.
„Du bist frustriert“, bemerkte Maya.
„Nö, mir geht’s gut. Glücklich und froh wie der Mops im Haferstroh.“ Er versuchte, es mit einem Grinsen abzutun, doch sie bemerkte es. „Es sollte eigentlich ,Glücklich und froh wie der Mops im Haferstroh, wenn es dort was Leckeres zu Fressen gibt‘ heißen. Weißt du eigentlich, woher das Sprichwort kommt? Einige meinen es stammt von…“
Er hielt inne, als sie ihre Arme verschränkte und eine Augenbraue hochzog. „Du bist frustriert. Oder irgendwas ärgert dich. Vielleicht auch beides. Du hast deine Schuhe nicht ausgezogen, als du hereinkamst. Du hast dir sofort ein Bier geholt, dir durch die Haare gefahren -“
Читать дальше