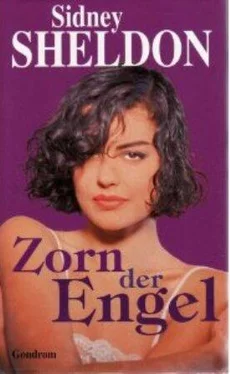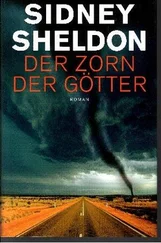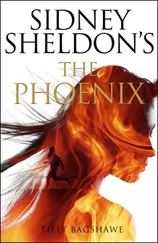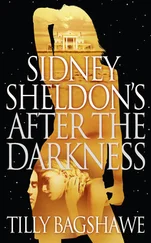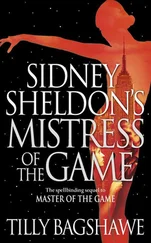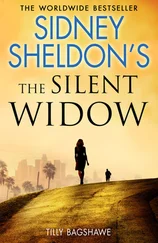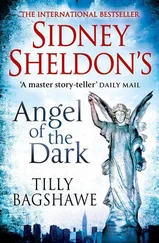Aber Jennifer war sicher, daß sie es schaffen würde. Sie erhielt die Mitteilung, daß sie bestanden hatte, und ein Angebot vom New Yorker Staatsanwaltsbüro am gleichen Tag. Eine Woche später war sie unterwegs nach Osten.
Sie fand ein winziges Appartement an der unteren Third Avenue (geräumig, Kamin, gute Lage, hatte es in der Anzeige geheißen), aber der Kamin war nur eine Imitation, und im Haus gab es keinen Fahrstuhl. Eine steile Treppe führte zu der Wohnung im vierten Stock. Das Treppensteigen wird mir guttun, sagte sich Jennifer. Schließlich gab es in Manhattan weder Berge, die man besteigen, noch Stromschnellen, über die man mit dem Kanu rasen konnte. Das Appartement bestand aus einem kleinen Wohnzimmer mit einer Couch, die sich in ein zerbeultes Bett verwandeln ließ, und einem winzigen Badezimmer, dessen Fenster vor langer Zeit von einem der Vormieter mit schwarzer Farbe überstrichen worden war, um einen Vorhang zu sparen. Das Mobiliar hätte gut und gern eine Spende der Heilsarmee sein können. Was soll's, lange werde ich hier sowieso nicht wohnen, dachte Jennifer. Es ist nur eine vorübergehende Lösung, bis ich mir einen Namen als Anwalt gemacht habe.
Soweit der Traum. Die Wirklichkeit sah so aus, daß sie noch keine zweiundsiebzig Stunden in New York war, als man sie bereits aus dem Stab des Staatsanwalts gefeuert hatte. Und jetzt stand ihr noch der Ausschluß aus der Anwaltskammer bevor.
Jennifer hörte auf, Zeitungen oder Illustrierte zu lesen, und verzichtete aufs Fernsehen, denn überall begegnete ihr nur ihr eigenes Antlitz. Sie hatte das Gefühl, daß die Leute sie anstarrten, auf der Straße, im Bus, beim Einkaufen. Sie begann, sich regelrecht zu verstecken, ging nicht ans Telefon und weigerte sich zu öffnen, wenn an der Tür geklingelt wurde. Sie erwog, ihre Koffer zu packen und nach Washington zurückzugehen. Sie erwog, sich eine andere Tätigkeit in einem anderen Beruf zu suchen. Sie erwog, sich umzubringen. Ganze Stunden verbrachte sie damit, Briefe an Staatsanwalt Di Silva zu entwerfen. Mal griff sie seine Gefühllosigkeit und seinen Mangel an Verständnis mit beißender Schärfe an, mal bat sie mit kriecherischen Entschuldigungen um eine neue Chance. Keiner
dieser Briefe wurde je abgeschickt. Zum erstenmal in ihrem Leben wurde Jennifer von Verzweiflung überwältigt. Sie hatte keine Freunde in New York, mit denen sie hätte sprechen können. Tagsüber schloß sie sich in ihrem Appartement ein. Erst spät nachts schlüpfte sie hinaus und wanderte durch die verlassenen Straßen der Stadt. Sie wurde nie belästigt. Vielleicht erblickte das menschliche Strandgut der Nacht seine eigene Einsamkeit und Verzweiflung in ihren Augen wie in einem Spiegel. Während sie ging, erlebte Jennifer im Geist wieder und wieder die Szene im Gerichtssaal, und jedesmal versah sie sie mit einem anderen Ende.
Ein Mann löste sich aus der Gruppe um Di Silva und kam an ihren Tisch. Er hielt einen Manilaumschlag in der Hand. Miß Parker? Ja?
Der Chef möchte, daß Sie das zu Stela bringen. Jennifer musterte ihn mit einem kühlen Blick. Könnte ich bitte Ihren Ausweis sehen? Der Mann erschrak und stürzte davon.
Ein Mann löste sich aus der Gruppe um Di Silva und kam an ihren Tisch. Er hielt einen Manilaumschlag in der Hand. Miß Parker? Ja?
Der Chef möchte, daß Sie das zu Stela bringen. Er reichte ihr den Umschlag. Sie öffnete ihn und entdeckte den toten Kanarienvogel. Ich verhafte Sie!
Ein Mann löste sich aus der Gruppe um Di Silva und näherte sich ihrem Tisch. Er hielt einen Manilaumschlag in der Hand. Er ging an ihr vorbei zu einem anderen jungen Assistenzanwalt und übergab ihm den Umschlag. Der Chef möchte, daß Sie das zu Stela bringen.
Sie konnte die Szene umschreiben, so oft sie wollte, an den Tatsachen änderte es nichts. Ein einziger Fehler hatte ihr Leben zerstört. Andererseits - wer sagte, daß es wirklich zerstört war? Die Presse? Di Silva? Noch war sie nicht ausgeschlossen, und bis das geschah, war sie immer noch Anwältin. Sie dachte an die ganzen Kanzleien, die ihr einmal Angebote gemacht hatten.
Sobald sie wieder zu Hause war, förderte Jennifer die Liste mit den Firmen zutage, bei denen sie sich vorgestellt hatte. Am nächsten Morgen begann sie zu telefonieren. Aber keiner der Männer war zu sprechen, und keiner rief zurück. Nach vier Tagen hatte sie endlich begriffen, daß sie ein Paria ihrer Zunft war. Der Staub, den der Moretti-Fall aufwirbelte, hatte sich wieder gelegt, aber jeder erinnerte sich noch daran. Jennifer hörte nicht auf, mögliche Arbeitgeber anzurufen, und aus ihrer Verzweiflung wurde Empörung, dann Niedergeschlagenheit und schließlich wieder Verzweiflung. Sie überlegte, was sie mit dem Rest ihres Lebens anfangen sollte, aber sie drehte sich im Kreis. Sie wollte Rechtsanwältin sein und sonst nichts. Und sie war Anwältin, und, bei Gott, sie würde diesen Beruf auch ausüben, bis man es ihr verbot. Als nächstes stellte sie sich persönlich bei den Anwaltspraxen und Kanzleien in Manhattan vor. Sie tauchte unangemeldet auf, nannte am Empfang ihren Namen und verlangte, einen der Seniorpartner zu sprechen. Gelegentlich wurde sie sogar vorgelassen, aber sie hatte das Gefühl, daß es mehr aus Neugier geschah. Sie war ein Monster, und man wollte sehen, wie sie in natura war. Aber meistens wurde ihr lediglich bedeutet, die Kanzlei sei komplett.
Nach sechs Wochen ging Jennifers Geld zu Ende. Sie wäre ja in ein billigeres Appartement umgezogen, nur gab es keine noch billigeren. Sie ließ Frühstück und Mittagessen aus, und ihr Abendessen nahm sie nur noch in einem kleinen Eckimbiß ein, wo das Essen zwar schlecht, die Preise aber gut waren. Sie entdeckte Lokale, wo sie eine ganze Mahlzeit für eine bescheidene Summe bekam - so viel Salat, wie sie essen, so viel Bier, wie sie trinken konnte. Jennifer konnte Bier nicht ausstehen, aber es machte satt.
Nachdem sie die Liste der großen Anwaltspraxen durchgegangen war, bewaffnete sie sich mit einer Aufstellung der kleineren und rief diese ebenfalls an, aber ihr Ruf war ihr sogar dorthin vorausgeeilt. Sie erhielt einen Haufen Anträge von den verschiedensten Männern, aber keinen Job. Gut, sagte sie sich schließlich, wenn mich niemand anstellen will, eröffne ich meine eigene Praxis. Der Haken war bloß, daß sie dafür Geld brauchte. Mindestens zehntausend Dollar, für Miete, Telefon, eine Sekretärin, Gesetzbücher, einen Schreibtisch, Stühle und Büromaterial. Zur Zeit hätte sie sich nicht einmal die Briefmarken leisten können.
Sie hatte auf ihr Gehalt vom Staatsanwaltsbüro gezählt, aber damit konnte sie jetzt natürlich nicht mehr rechnen. Eine Abfindung brauchte sie ebenfalls nicht zu erhoffen. Wenn jemand enthauptet wird, erhält er ja auch keine Entschädigung. Nein, es war ihr einfach nicht möglich, eine eigene Praxis zu eröffnen, nicht einmal eine kleine. Die einzige Lösung war ein gemeinsames Büro mit jemand anderem. Jennifer kaufte die New York Times und ging die Anzeigen durch. Am Ende der letzten Spalte entdeckte sie schließlich eine Zeile, die lautete: Gesucht: Dritter Mann für kleine Bürogemeinschaft. Geringe Restmiete. Die beiden letzten Worte gefielen Jennifer außerordentlich gut. Sie war zwar kein Mann, aber bei einer Bürogemeinschaft spielte das Geschlecht ja auch keine Rolle. Sie riß die Anzeige heraus und fuhr mit der U-Bahn zur angegebenen Adresse.
Es war ein verwahrlostes, baufälliges Gebäude am unteren Broadway. Das Büro lag im zehnten Stock, und auf dem abblätternden Schild an der Tür stand:
KENNETH BAILEY AUSKUNFTEI
Und darunter:
ROCKEFELLER INKASSOBÜRO
Jennifer holte rief Luft, stieß die Tür auf und trat ein. Ihr erster Schritt brachte sie in die Mitte eines kleinen, fens terlosen Büros. In den Raum hatte man drei wackelige Tische und Stühle gezwängt. Zwei davon waren besetzt.
An einem der Tische saß ein kahlköpfiger, schäbig gekleideter Mann mittleren Alters über einen Stapel Papiere gebeugt. An einem zweiten Tisch an der gegenüberliegenden Wand arbeitete ein zweiter Mann, den Jennifer auf Anfang Dreißig schätzte. Er hatte ziegelrotes Haar und leuchtendblaue Augen. Seine Haut war blaß und mit Sommersprossen übersät. Er trug hautenge Jeans, ein T-Shirt und weiße Tennisschuhe ohne Socken. Er telefonierte.
Читать дальше