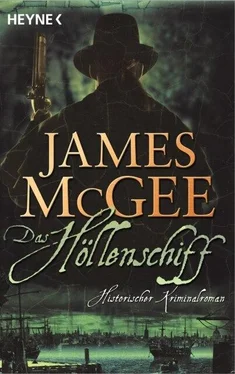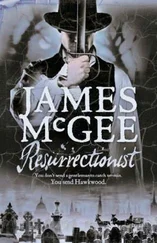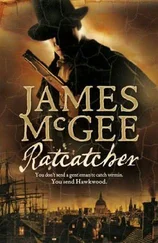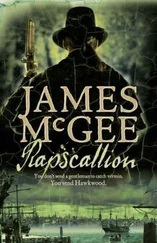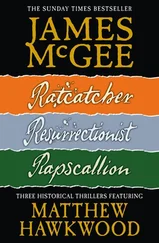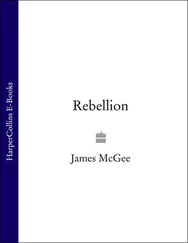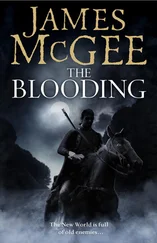Lasseur stand neben ihm. Der Privateer hatte zum vielleicht hundertsten Male die Zigarre aus seiner Jackentasche geholt und starrte sie mit derselben Konzentration an wie ein Trinker eine Flasche Rum.
Hawkwood spürte, dass jemand hinter ihm stand.
Es war der Lehrer, Fouchet, dessen fassungsloses Gesicht Hawkwood sofort verriet, dass etwas Schlimmes geschehen sein musste.
»Sébastien?«, sagte Lasseur vorsichtig fragend.
Fouchet starrte ihn an, als wisse er nicht, wo er anfangen sollte. Man sah, dass er verzweifelt war.
»Sébastien?«, sagte Lasseur nochmals.
Das Gesicht des Lehrers war vor Schmerz verzerrt. »Sie haben sich den Jungen geschnappt.«
Hawkwood runzelte die Stirn. »Wer? Die Wachen?«
Fouchet schüttelte den Kopf. »Die Römer.«
Lasseur hielt vor Schreck die Luft an, die Zigarre hatte er vergessen. »Was? Wie ist das passiert?«
»Ich schickte ihn nach dem Unterricht in die Küche, weil es Zeit war, Samuel mit dem Abendessen zu helfen. Er kam nie dort an. Das habe ich aber erst später erfahren, als ich hinging, um unsere Rationen abzuholen.« Der Lehrer rang die Hände. »Ich hätte ihn begleiten sollen. Es ist meine Schuld.«
Es war Lasseurs Vorschlag gewesen, den Jungen als Küchenhelfer zu beschäftigen.
»Woher wissen Sie, dass die Römer ihn haben?«, fragte Hawkwood. »Könnte er nicht bei den anderen Jungen sein?«
Die Bewohner des Orlopdecks hatten sich seit ihrem Überfall im Park sehr zurückgehalten - zumindest als Gruppe. Einzeln unternahmen sie immer noch Raubzüge auf das Vordeck, wo sie nach Abfällen stöberten oder Gelegenheiten zu einem Tauschgeschäft suchten, obwohl die anderen Gefangenen ihnen meist eine Abfuhr erteilten. Die Gegenwart der Römer als Gesamtheit, die ja nur ein Deck tiefer lebten, lag jedoch wie ein dunkler Schatten über den anderen Gefangenen. Sie erinnerten Hawkwood an die Unberührbaren, die er in Indien gesehen hatte; sie wurden gehasst und gefürchtet, aber es war unmöglich, sie zu ignorieren.
Fouchet schüttelte den Kopf. »Ich habe mit Millet und Charbonneau gesprochen. Sie haben herumgefragt. Lucien wurde mit Juvert gesehen.«
»Wer ist Juvert?«, fragte Hawkwood.
»Den kenne ich«, sagte Lasseur. »Dieser verfluchte Päderast! Den habe ich doch gleich am ersten Tag dabei erwischt, wie er sich an Lucien heranmachen wollte. Ich warnte ihn, er solle den Jungen in Ruhe lassen.«
Hawkwood fiel der degeneriert aussehende Mann wieder ein, der neben dem Jungen gehockt und mit seinen schlanken Fingern dessen Rücken getätschelt hatte. »Der ist ein Römer?«
»Er ist einer von Matisses Gefolgsleuten«, sagte Fouchet.
»Matisse?«
»Ein widerwärtiger Kerl, nennt sich König der Römer. Er regiert auf der untersten Ebene. Noch dazu ein Korse, wenn Sie sich das vorstellen können«, fügte der Lehrer verächtlich hinzu.
»Dieser wilde Haufen hat einen Anführer?« Lasseur konnte seine Skepsis kaum verbergen.
»Und was ist mit den Wachen?«, fragte Hawkwood, der sich wunderte, warum Matisse sich König nannte. Die alten Römer waren doch von einem Kaiser regiert worden? Aber wenn man es recht bedachte, dann war ein korsischer Kaiser wahrscheinlich erst mal genug. Ihm fiel wieder der Kommentar ein, den er bei seiner Ankunft auf dem Schiff von den Wachen gehört hatte, als sie den Jungen sahen:
Warte mal, bis seine Majestät das sieht!
Hawkwood merkte, dass ihm übel wurde.
Fouchet schüttelte den Kopf. »Die machen gar nichts. Es ist ja nichts Verbotenes passiert. Und außerdem trauen die sich gar nicht so weit unter Deck.«
Hawkwood sah den Lehrer eindringlich an. »Es ist doch ein britisches Schiff! Wollen Sie damit sagen, dass die britische Navy auf einem ihrer eigenen Schiffe keine Macht hat?«
Fouchet breitete die Hände aus. »Die Macht hat sie schon. Aber es fehlt der Wille , besonders wenn die Römer im Spiel sind. Ehrlich gesagt, ich glaube, der Commander und seine Männer haben mehr Angst vor Matisse und seinem Hofstaat als wir.«
»Aber die Briten sind doch bewaffnet. Sie haben Musketen!«, protestierte Lasseur.
»Stimmt, aber Sie haben es ja selbst gesehen: Sie benutzen sie nicht, es sei denn, einer ihrer eigenen Männer ist bedroht.«
Entsetzt sah Lasseur den Lehrer an, der unter dem Blick noch ratloser wurde.
»Das hatten Sie also gemeint, nicht wahr?«, sagte Lasseur schließlich. »Deshalb hatten Sie mir geraten, ihn im Auge zu behalten. Matisse hat das schon mehrmals gemacht. Er hat sich auch andere Jungens geholt. Mein Gott, wo sind wir hier bloß?«
»Wenn ich Ihnen auch nur die Hälfte von allem erzählte«, sagte Fouchet leise, »würden Sie mich für verrückt erklären.«
»Und was ist mit dem Gericht, das die Gefangenen unter sich abhalten? Hat das denn keinen Einfluss?«
Fouchet schüttelte den Kopf. »Nein, nicht auf Matisse. Außerdem ist Gericht eigentlich nur ein anderes Wort für Komitee. Und wann hat ein Komitee jemals etwas Vernünftiges zuwege gebracht? Außerdem, bis die sich zusammengefunden haben, wäre es zu spät. Wir müssen jetzt etwas unternehmen!«
Du lieber Gott!, dachte Hawkwood in Panik.
»In Ordnung. Von Charbonneau wissen wir, dass alles, was unter Deck passiert, auch unter Deck bleibt. Also werden wir uns selbst darum kümmern.«
»Wie?« Fouchet hob ruckartig den Kopf und sah ihn an. »Moment mal, wollen Sie etwa dort runter gehen?«
»Es sei denn, Ihnen fällt eine andere Lösung ein«, erwiderte Hawkwood. Er wartete auf eine Antwort.
Fouchet sah ihn hilflos an.
»Dieser Matisse, können Sie uns zu ihm bringen?«, fragte Lasseur.
Fouchet wurde noch blasser. Er trat einen Schritt zurück, wobei er fast hintenübergefallen wäre.
In Lasseurs Augen flammte kurz Zorn auf, sein Gesicht wurde hart. Aber als er Fouchet anstarrte, sah er auch die Angst in dessen Gesicht.
»Wir verschwenden kostbare Zeit«, sagte Hawkwood.
»Es tut mir schrecklich leid«, flüsterte Fouchet. Sein Gesicht war schlaff. Plötzlich sah er sehr alt und sehr hinfällig aus.
Lasseur lächelte dem Lehrer beruhigend zu. »Wir kriegen ihn zurück, Sébastien, darauf gebe ich Ihnen mein Wort.« Er wandte sich an Hawkwood. »Vielleicht sollten wir uns bewaffnen?«
Der sah Fouchet an. »Haben die dort unten Waffen?«
Fouchet nickte unglücklich. »Das ist möglich.«
»Na, wunderbar«, sagte Lasseur. »Und was machen wir jetzt?«
»Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Hellard uns den Schlüssel zur Waffenkammer aushändigt«, sagte Hawkwood trocken. »Und Zeit zum Suchen haben wir auch nicht. Wir müssen halt improvisieren.« Er wandte sich an Fouchet. »Wo ist Juvert? Haben Sie ihn gesehen, seit der Junge verschwunden ist?«
In den Augen des Lehrers erschien ein Schimmer von Hoffnung. Er nickte und deutete mit dem Finger.
Claude Juvert kostete den Moment aus. Er stand auf dem Schnabeldeck im Kopf des Schiffes und pinkelte. Er genoss es, denn hier von der Pissrinne aus hatte man einen wunderbaren Blick über den Fluss, solange man nach vorn schaute und die hässlichen Hecks der anderen Gefängnisschiffe ignorierte, die vor dem Bug aufragten. Natürlich stank es hier bestialisch, aber das war unvermeidlich, obwohl das Deck gegen die Elemente offen war. Die Schiffslatrine hatte nur sechs Sitze, und bei mehr als achthundert Gefangenen an Bord kam es nur äußerst selten vor, dass nicht alle gleichzeitig besetzt waren. Jetzt saßen vier Häftlinge hinter Juvert, ihre Hosen bis auf die Knöchel herunter geschoben, und meditierten über ihr Schicksal. Nur ab und zu wechselten sie ein Wort.
Wäre die Rapacious unter vollem Segel auf See gewesen, hätte man den Gestank kaum wahrgenommen. Die Salzwassermassen, die ständig über das Netz am Bug hinwegschwappten, hätten dafür gesorgt, dass das Deck regelmäßig gewaschen wurde. Die Fäkalienreste, die sich um die Löcher ansammelten, wären ohne große Mühe beseitigt worden. Doch ein Schiff, das mitten auf einem Fluss vor Anker lag, der fast immer ruhig war und wo nur selten ein wenig Wellengang die Monotonie unterbrach, waren die sanitären Einrichtungen alles andere als befriedigend. In diesem Bereich war das Deck ziemlich nass und glitschig. Juvert schüttelte die letzten Tropfen ab, knöpfte seine Hose zu und wischte die Hände an der Jacke ab. Mit einem kleinen befriedigten Seufzer wandte er sich zum Gehen.
Читать дальше