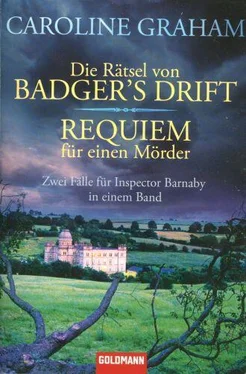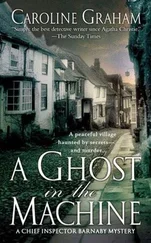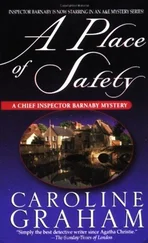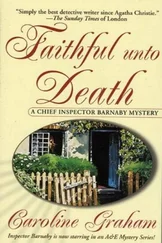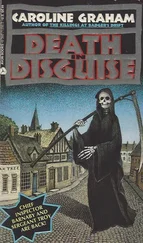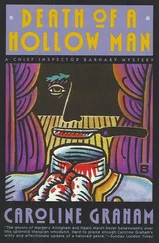»Ich dachte doch, daß ich Stimmen gehört habe.« Sie sank in den Sessel neben dem Fenster, legte ihre Füße auf einen Schemel und schenkte den beiden Polizisten ein bezauberndes Lächeln. Sie sieht aus wie eine von diesen Frauen, die in den Magazinen mit den aufklappbaren Seiten zu sehen sind, dachte Troy, während er ihre Kurven, die sich deutlich unter dem Frotteeoverall abzeichneten, ihre üppige Haarmähne und die schimmernden Lippen betrachtete. Ihre schlanken, gebräunten Füße steckten in hochhackigen goldenen Sandalen. Barnaby fiel auf, daß sie längst nicht mehr so jung war, wie sie durch kosmetische Höchstleistungen und durch viel Geld vortäuschen wollte. Sie war nicht mehr Anfang Dreißig, sondern eher Mitte, vielleicht sogar Ende Vierzig.
Auf seine Fragen hin erklärte sie, sie sei am Nachmittag in Causton einkaufen gewesen und habe den Abend bis auf einen kurzen Zeitraum, in dem sie mit dem Auto unterwegs gewesen war, zu Hause verbracht.
»Hatten Sie ein spezielles Ziel bei dieser Fahrt?«
»Nein ... na ja, um ehrlich zu sein, wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit, stimmt’s, Pookie?«
»Ich kann mir nicht vorstellen, daß unsere Streitereien für die Polizei von Interesse sind, meine Liebe«, brummte Lessiter.
»Ich habe mein Kleiderbudget überschritten, und das machte ihn wütend. Deshalb stieg ich in den Jaguar und fuhr ein wenig herum, bis ich glaubte, daß er sich beruhigt hatte. Dann kam ich zurück.«
»Und wann war das genau?«
»Es war etwa sieben, als ich das Haus verließ, denke ich. Und ich war vielleicht eine Stunde unterwegs.«
»War Miss Lessiter hier, als Sie nach Hause kamen?«
»Judy?« Sie sah ihre Stieftochter stirnrunzelnd und unbeteiligt an, als würde sie sich fragen, was sie überhaupt hier zu suchen hatte. »Ich habe nicht die geringste Ahnung. Sie hält sich die meiste Zeit in ihrem Zimmer auf. Wie Jugendliche eben so sind.«
Barnaby fand, daß die Bezeichnung »Jugendliche« keineswegs zu der trägen Gestalt paßte, die jetzt das halbe Sofa für sich beanspruchte. Jugendliche waren zwar scheu, unbeholfen und launisch, aber auch lebenslustig und temperamentvoll. Judy hingegen schien schon als Erwachsene auf die Welt gekommen zu sein.
»Haben Sie irgendwo haltgemacht, Mrs. Lessiter? Um etwas zu trinken vielleicht?«
»Nein.«
»Gut, vielen Dank.« Als Barnaby aufstand, hörte er die Klappe des Briefkastens zufallen, Judy hievte sich vom Sofa und watschelte hinaus.
Ihre Stiefmutter sah Barnaby vielsagend an. »Sie ist verliebt. Jedesmal, wenn die Post kommt oder das Telefon klingelt, erleben wir ein kleines Drama.« Ihr strahlendes, unechtes Lächeln galt allen drei Männern. Ist die Kleine nicht eine lächerliche Figur? sagte dieses Lächeln, als müßten ihr alle zustimmen. »Ein furchtbarer Mann - aber er sieht umwerfend gut aus, und das macht alles noch viel schlimmer.«
Trevor Lessiter hielt seine Zeitung so fest, daß die Knöchel an seinen Fingern weiß wurden. Judy kam mit einem Stapel Briefen zurück. Einen warf sie in Barbaras Schoß, den Rest kippte sie hinter den Daily Telegraph. Ihr Vater schnalzte aufgebracht mit der Zunge.
Nachdem sie das Haus verlassen hatten, blieb Barnaby stehen, um die Madame-de-Coultre-Clematis zu bewundern, die an der Säule am Eingang rankte. Dann drehte er sich noch einmal um und sah, daß Barbara Lessiter am Fenster des Wohnzimmers stand und blicklos in den Garten starrte. Blanke Angst stand ihr im Gesicht. Barnaby beobachtete, wie sie den Brief zusammenknüllte und in die Tasche ihres Overalls stopfte.
»Was ist los, Stiefmama?«
»Nichts.« Barbara ging zurück zu dem Sessel. Sie sehnte sich nach einem starken, schwarzen Kaffee. Alles stand auf dem niedrigen Tischchen vor dem Sofa bereit, aber ihre zitternden Hände würden sie verraten.
»Du bist bleich wie das sprichwörtliche Laken unter all dieser dicken Pariser Schminke.« Judy starrte die ältere Frau unverhohlen an. »Du bist doch nicht schwanger, oder?«
»Selbstverständlich nicht.«
»Selbstverständlich nicht«, echote Judy. »Die Zeiten sind für dich längst vorbei, nicht wahr?«
»Hast du eine Zigarette für mich, Trevor?«
Ihr Mann erwiderte, ohne den Blick von der Zeitung zu wenden: »In der Dose auf meinem Schreibtisch sind welche.«
Barbara nahm eine und klopfte mit der Spitze so heftig auf den Dosendeckel, daß das Tabakpapier fast aufplatzte. Sie zündete die Zigarette mit dem Feuerzeug an, das aussah wie ein Fußball, und stellte sich wieder mit dem Rücken zu den anderen ans Fenster. Das unterschwellig feindselige Schweigen dehnte sich in die Länge.
Judy Lessiter richtete einen brennenden Blick auf die Zeitung, hinter der sich ihr Vater verschanzt hatte. Am liebsten hätte sie diesen Schutzschild versengt wie ein durch eine Lupe verstärkter Sonnenstrahl und zugesehen, wie sich das Papier erst braun, dann schwarz verfärbte und in Flammen aufging, um sein dümmliches, erstauntes Gesicht freizugeben.
Der schreckliche Tag, an dem die beiden mit identischen goldenen Ringen an den Fingern auf der Schwelle gestanden hatten, lag jetzt fünf Jahre zurück. Er war die vorangegangene Nacht außer Haus gewesen und hatte ihr weisgemacht, er müßte bei einem sterbenden Patienten bleiben. Diese abscheuliche, gemeine Lüge würde sie ihm nie verzeihen können. Sie war nicht einmal mehr sicher, ob sie ihn noch liebhaben konnte. Ihre Freude an seinem täglich wachsenden Unbehagen und seinem Unglück sprach eindeutig dagegen.
Vom ersten Augenblick an hatte sie heftigen Widerstand geleistet gegen Barbaras halbherzige Versuche, ihr Ratschläge mit den Kleidern und dem Make-up zu geben und ihr Zimmer anders einzurichten. Sie mochte ihr Zimmer so, wie es immer gewesen war - mit den alten Spielsachen, der Patchwork-Decke, den Schulbüchern und allem anderen -, und fand Barbaras Vorschläge, es mit gerüschten Vorhängen, kitschigen Tapeten und Teppichen femininer zu gestalten, fürchterlich. Sie war auch, sagte sie sich selbst, viel zu intelligent, um sich mit den blöden Zeitschriften zu befassen, die Barbara unaufhörlich las. Barbara hatte sie mit Diätvorschriften gequält, als wäre man ein neuer Mensch, wenn man sich halb zu Tode hungert! Aber die gute Stiefmama behielt das mütterliche Getue nicht lange bei und verfolgte bald ihre eigene tägliche Routine, an der sie seither festhielt. Sie gab der Haushaltshilfe Anweisungen, ging zum Friseur, ins Fitneßstudio und in Boutiquen und lümmelte ansonsten im Haus herum, um sich mit Modemagazinen und den albernen Frauenzeitschriften zu beschäftigen.
Judy war nicht glücklich. Seit dem Tod ihrer Mutter war sie nicht mehr glücklich, nicht mehr so unbeschwert und frei wie ein behütetes und von beiden Elternteilen geliebtes Einzelkind gewesen. Doch das Elend von Barbara und ihrem Vater tröstete sie über manches hinweg. Und dann war da noch Michael Lacey. Vielmehr er war nicht für sie da, und er würde es auch niemals sein - das mußte sie sich immer und immer wieder sagen, wenn sich das kleine Würmchen Hoffnung in ihr Herz schlängelte. Nicht nur weil er viel zu gut aussah (selbst noch nach seinem Unfall war sein Gesicht wunderschön), sondern auch wegen seiner Arbeit. Ein Maler mußte frei sein. Erst letzte Woche hatte er ihr erzählt, daß er auf Reisen gehen wollte, um in Venedig, Florenz und Spanien zu studieren. Ihr entfuhr ein gequälter Schrei: »Wann, wann?«, aber er erwiderte nur mit einem Achselzucken: »Eines Tages ... bald.« Seit ihrer Verlobung war seine Schwester Katherine kaum noch zu Hause, und Judy ging manchmal zu seinem Cottage, räumte auf, putzte ein bißchen und kochte ihm Kaffee. Nicht zu oft. Sie versuchte, ihre Besuche zu dosieren, in der Hoffnung, daß er sie dann hin und wieder vermissen würde.
Vor zwei Wochen hatte er ihren Arm genommen und sie zum Fenster geführt, einen Finger unter ihr Kinn gelegt und ihr Gesicht eingehend gemustert. »Ich möchte dich malen. Du hast faszinierende Augen«, sagte er in sachlichem Ton, als wäre er ein Bildhauer und sie ein vielversprechender Steinklumpen, aber Judys Herz schmolz dahin, und ihre Träume nahmen eine neue Dimension an. Er hatte nie wieder davon gesprochen. Erst neulich war sie abends zu seinem Cottage gegangen und hatte durchs Fenster gesehen, daß er arbeitete. Sie war wieder weggeschlichen, weil sie nicht den Mut aufbrachte, ihn zu stören. Seither war sie nicht mehr bei ihm gewesen - sie fürchtete, daß sie seine Geduld mit einem unerwünschten Besuch zu sehr auf die Probe stellen und das herbeiführen könnte, was für sie der furchtbarste Schicksalsschlag wäre: die endgültige Zurückweisung.
Читать дальше