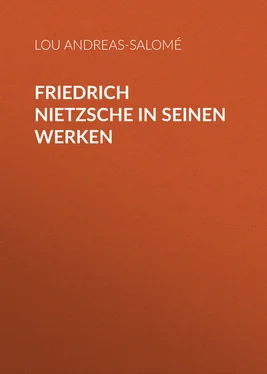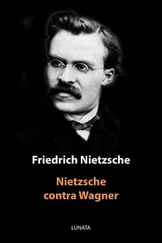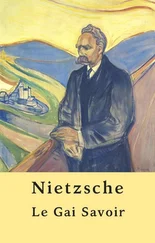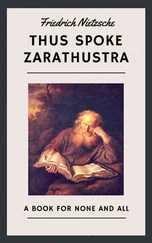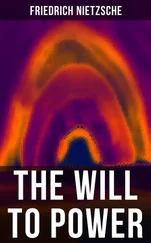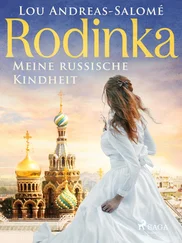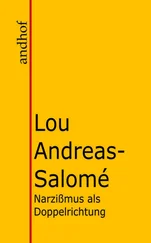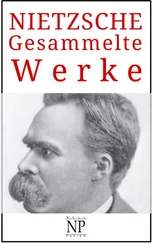Lou Andreas-Salomé - Friedrich Nietzsche in seinen Werken
Здесь есть возможность читать онлайн «Lou Andreas-Salomé - Friedrich Nietzsche in seinen Werken» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: foreign_antique, foreign_prose, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Friedrich Nietzsche in seinen Werken
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Friedrich Nietzsche in seinen Werken: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Friedrich Nietzsche in seinen Werken»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Friedrich Nietzsche in seinen Werken — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Friedrich Nietzsche in seinen Werken», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Diese Worte sind der Antrittsvorlesung Nietzsches an der Baseler Universität »Homer und die Klassische Philologie« (24) entnommen, die (Basel 1869) nur für Freunde gedruckt worden ist. Zwei Jahre später erschien (Basel 1871) eine andere kleine Schrift derselben Geistesrichtung: »Sokrates und die griechische Tragödie«, welche indessen fast vollständig, mit nur äusserlichen Umstellungen des Gedankenzusammenhangs, in das 1872 veröffentlichte erste grössere philosophische Werk Nietzsches: »Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik« (Leipzig, E. W. Fritsch, jetzt C. G. Naumann) 17 17 Dieses Buch erregte bei seinem Erscheinen das lebhafteste Missfallen der philologischen Zunft; hatte der Verfasser es doch gewagt, seinen Ausführungen nicht nur die Lehren des verpönten Philosophen Arthur Schopenhauer, sondern auch die künstlerischen Anschauungen des damals noch ebenso geschmähten »Zukunftsmusikers« Richard Wagner zu Grunde zu legen. Ein junger philologischer Heisssporn, Ulrich v. Wilamowitz-Möllendorf, der jetzt zu den hervorragenden Vertretern der classischen Philologie in Deutschland gehört, machte sich in nicht besonders glücklicher und geschmackvoller Weise zum Sprachrohr zünftiger Einseitigkeit. Ohne der Eigenart des Nietzscheschen Buches irgendwie gerecht zu werden, griff er es in der Broschüre »Zukunftsphilologie! eine erwidrung auf F. N.'s »gebürt der tragödie«, Berlin 1872, von einem beschränkt philologischen Standpunkte auf das heftigste an. Für den Angegriffenen traten in die Schranken derjenige, an den vor Allen das Buch gerichtet war, Richard Wagner, der Künstler, in einem in der »Norddeutschen Allgemeinen Zeitung« vom 23. Juni 1872 abgedruckten offenen Briefe an Friedrich Nietzsche, und Erwin Rohde, der bereits damals von seiner tiefen Kenntnis des griechischen Alterthums die vollgiltigsten Proben abgelegt hatte. In der ausgezeichnet geschriebenen Streitschrift: »Afterphilologie. Sendschreiben eines Philologen an Richard Wagner«, Leipzig 1872, stellte er sich auf den von dem Gegner gewählten Boden und wies die von diesem gemachten Einwände und Beschuldigungen zurück, worauf v. Wilamowitz dann noch mit einer Duplik, »Zukunftsphilologie! Zweites Stück, eine erwidrung auf die rettungsversuche für F. N.'s »gebürt der tragödie«, Berlin 1873, antwortete.
aufgenommen worden ist. In diesen beiden Arbeiten baute Nietzsche seine culturphilosophischen Ausführungen noch auf streng philologischer Grundlage auf; und sie alle haben dazu beigetragen, seinen Namen unter den philologischen Fachgenossen zu verbreiten. Dennoch bezeichnen sie schon den Weg, den er, von seinem ursprünglichen Fachstudium aus, durch Kunst und Geschichte hindurch, zurückgelegt hatte, um schliesslich in die geschlossene Weltanschauung einer bestimmten Philosophie einzutreten. Es war die Weltanschauung Richard Wagners, die Verknüpfung seines Kunststrebens mit Schopenhauers Metaphysik. Wenn wir das Werk aufschlagen, so befinden wir uns mitten im Bannkreis des Meisters von Bayreuth.
Durch ihn erst vollzog sich für Nietzsche die volle Verschmelzung von Philologenthum und Philosophenthum, wurde erst jenes Wort wahr, womit er seinen »Homer und die klassische Philologie« schliesst, indem er einen Ausspruch des Seneca umkehrt: »philosophia facta est quae philologia fuit,« »damit soll ausgesprochen sein, dass alle und jede philologische Thätigkeit umschlossen und eingehegt sein soll von einer philosophischen Weltanschauung, in der alles Einzelne und Vereinzelte als etwas Verwerfliches verdampft und nur das Ganze und Einheitliche bestehen bleibt.«
Der Zauber, der Nietzsche auf Jahre hinaus zum Jünger Wagners machte, erklärt sich namentlich daraus, dass Wagner innerhalb des germanischen Lebens dasselbe Ideal einer Kunstcultur verwirklichen wollte, welches Nietzsche innerhalb des griechischen Lebens als Ideal aufgegangen war. Mit der Metaphysik Schopenhauers trat im Grunde nichts anderes hinzu, als eine Steigerung dieses Ideals ins Mystische, ins unergründlich Bedeutungsvolle, – gleichsam ein Accent, den es durch die metaphysische Interpretation alles Kunsterlebens und Kunsterkennens noch erhielt. Diesen Accent empfindet man am deutlichsten, wenn man den »Sokrates und die griechische Tragödie« vergleicht mit der Ergänzung und Erweiterung, die derselbe in dem Hauptwerk: »Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik« erhalten hat. In diesem Buche sucht Nietzsche alle Kunstentwicklung auf die Bethätigung zweier entgegengesetzter »Kunsttriebe der Natur« zurückzuführen, die er nach den beiden Kunstgottheiten der Griechen als das Dionysische und das Apollinische bezeichnet. Unter ersterem versteht er das orgiastische Element, wie es sich in den wonnevollen Verzückungen, in der Mischung von Schmerz und Lust, von Freude und Entsetzen, in der selbstvergessenen Trunkenheit Dionysischer Feste auslebte. In ihnen sind die gewöhnlichen Schranken und Grenzen des Daseins vernichtet, scheint das Individuum wieder mit dem Naturganzen zu verschmelzen; zerbrochen ist das Principium individuationis; »der Weg zu den Müttern des Seins, zu dem innersten Kern der Dinge liegt offen« (86). Näher gebracht wird uns das Wesen dieses Triebes durch die physiologische Erscheinung des Rausches. Die ihm entsprechende Kunst ist die Musik. Den Gegensatz bildet der formenbildende Trieb, der in Apollo, dem Gott aller bildnerischen Kräfte, verkörpert ist. In ihm vereinigt sich maassvolle Begrenzung, Freiheit von allen wilderen Regungen und weisheitsvolle Ruhe. Er muss als der erhabene Ausdruck, als »die Vergöttlichung des »Principii individuationis« (16) betrachtet weiden, »dessen Gesetz das Individuum, d. h. die Einhaltung der Grenzen desselben, das Maass im hellenischen Sinne ist« (17). Die Macht des durch ihn symbolisirten Triebes offenbart sich physiologisch in dem schönen Schein der Welt des Traumes. Seine Kunst ist die plastische des Bildners.
In der Versöhnung und Verbindung dieser beiden sich anfänglich bekämpfenden Triebe erkennt Nietzsche Ursprung und Wesen der attischen Tragödie, die als die Frucht der Versöhnung der beiden widerstrebenden Kunstgottheiten ebenso sehr dionysisches als apollinisches Kunstwerk ist. Entstanden aus dem dithyrambischen Chor, der die Leiden des Gottes feierte, ist sie ursprünglich nur Chor, dessen Sänger durch die dionysische Erregung so verwandelt und verzaubert wurden, dass sie sich selbst als Diener des Gottes, als Satyrn, empfanden und als solche ihren Herrn und Meister Dionysos schauten. Mit dieser Vision, die der Chor aus sich erzeugt, gelangt sein Zustand zu apollinischer Vollendung. Das Drama als »die apollinische Versinnlichung dionysischer Erkenntnisse und Wirkungen« ist vollständig. »Jene Chorpartien, mit denen die Tragödie durchflochten ist, sind also gewissermassen der Mutterschoss des eigentlichen Dramas« (41); sie sind das dionysische Element desselben, während der Dialog den apollinischen Bestandteil bildet. In ihm sprechen von der Scene aus die Helden des Dramas als die apollinischen Erscheinungen, in denen sich der ursprüngliche tragische Held Dionysos objectivirt, als blosse Masken, hinter denen allen die Gottheit steckt.
Wir werden am Schlüsse unseres Buches sehen, in welch eigenthümlicher Weise Nietzsche ganz zuletzt noch einmal auf diesen Gedanken zurückgriff, indem er seine verschiedenen Entwicklungsperioden und Gesinnungswandlungen so darzustellen versuchte, als seien sie nicht unmittelbare Aeusserungen seines Geistes gewesen, sondern gewissermaassen nur willkürlich vorgehaltene Masken, »apollinische Scheinbilder«, hinter denen sein dionysisches Selbst, göttlich überlegen, das ewig gleiche geblieben sei. Die Ursachen dieser Selbsttäuschung werden wir am Schlüsse erkennen.
Die Bedeutung, die Nietzsche dem Dionysischen beimisst, ist charakteristisch für seine ganze Geistesart: als Philolog hat er mit seiner Deutung der Dionysoscultur einen neuen Zugang zur Welt der Alten gesucht; als Philosoph hat er diese Deutung zur Grundlage seiner ersten einheitlichen Weltanschauung gemacht; und über alle seine spätem Wandlungen hinweg taucht sie noch in seiner letzten Schaffensperiode wieder auf; verwandelt zwar, insofern ihr Zusammenhang mit der Metaphysik Schopenhauers und Wagners zerrissen ist: aber sich doch gleich geblieben in dem, worin schon damals seine eignen verborgenen Seelenregungen nach einem Ausdruck suchten; verwandelt erscheint sie zu Bildern und Symbolen seines letzten, einsamsten und innerlichsten Erlebens. Und der Grund dafür ist, dass Nietzsche im Rausch des Dionysischen etwas seiner eignen Natur Homogenes herausfühlte: jene geheimnissvolle Wesenseinheit von Weh und Wonne, von Selbstverwundung und Selbstvergötterung, – jenes Uebermass gesteigerten Gefühlslebens, in welchem alle Gegensätze sich bedingen und verschlingen, und auf das wir immer wieder zurückkommen werden.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Friedrich Nietzsche in seinen Werken»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Friedrich Nietzsche in seinen Werken» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Friedrich Nietzsche in seinen Werken» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.