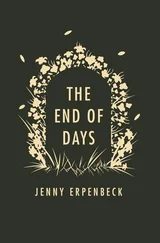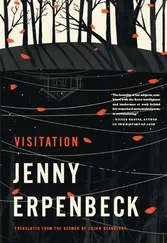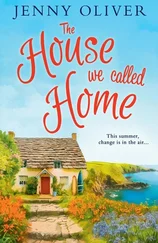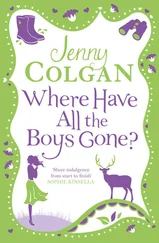Am Montag geht Richard den Weg zu dem roten Ziegelgebäude beinahe schon mit der gleichen Selbstverständlichkeit, wie er in der ersten Jahreshälfte noch den Weg zur Uni gegangen ist. Überquert die Straße mit dem buckligen Kopfsteinpflaster, welche Sträflinge haben den Granit wohl zersägt und geschliffen? Geht an dem leeren Grundstück vorüber, auf dem bis vor kurzem ein großes Haus mit Erkern, einer verglasten Veranda und hölzernen Schnitzereien stand, jetzt ist da nur noch heller Sand und wartet auf einen Neubau, mit nichts kann man Geschichte leichter zum Verschwinden bringen, als wenn man Geld freilässt, bissiger als ein Kampfhund ist so ein freilaufendes Geld, beißt ein ganzes Haus mit Leichtigkeit weg, denkt Richard und erreicht schon die Geschwindigkeitsanzeige, die vor dem Altersheim am Straßenrand steht, Tempo 30 ist hier erlaubt, aber 70, 55 und 60 leuchten in einer digitalen Schrift auf, sobald ein Auto vorbeifährt, hinterher wird gebremst, das kennt man, Scham und Reue, das krumme Pärchen, das auch ihn zum Ducken gebracht hat, immer erst, wenn’s schon zu spät war, wenn seine Frau einen von ihm schlecht versteckten Brief seiner Geliebten schon in der Hand hielt und dastand und schrie. Aus dem Altersheim, in dem er vielleicht einmal seinen Lebensabend verbringen wird, kommt eine alte Frau heraus, die sich an einem Gehgestell festhält, ihr Einkaufsbeutel baumelt am grauen Griff des Gestells, und so langsam, wie sie vorankommt, ist der Einkauf wahrscheinlich ihr ganzes Vormittagsprogramm.
Beim Eintritt in das Backsteingebäude wird Richard vom Wachdienst gesagt, dass die Männer heute beim Deutschunterricht seien: immer montags und donnerstags. Warum sollte er dann nicht auch zum Deutschunterricht gehen? Natürlich nur, wenn die Lehrerin Ja sagt. Immer den Gang hinunter und dann um die Ecke. Die Lehrerin ist, ganz anders als er es sich vorgestellt hat, eine junge Frau aus Äthiopien, die, warum auch immer, exzellent Deutsch spricht. Sie sagt Ja, und so kommt es, dass an diesem Montag ein emeritierter Professor in ihrem Unterricht sitzt. In die vorletzte Reihe des großen Raums hat er sich gesetzt und seine Knie unter den Schultisch gezwängt, Apoll sitzt zwei Reihen vor ihm und liest in seinen Papieren, sitzen, saß, gesessen, noch weiter vorn sieht er Tristan, der ihn bemerkt hat und ihm jetzt zunickt. Er nickt zurück. Ob der Gebeugte da vorn Abdusalam ist, der ihm letzte Woche das Lied vorgesungen hat, weiß er nicht genau. Trug dieser Abdusalam nicht die Haare zu kleinen Zöpfen geflochten? Überhaupt ist es schwer für Richard, sich an irgendwen zu erinnern, die Haare und die Gesichter sind ja alle so schwarz. Nur Raschid würde er sofort erkennen, weil er so groß ist, aber Raschid ist nicht da.
Die junge Frau übt mit ihren erwachsenen Schülern das Buchstaben-Lesen. Dann das Worte-Lesen. Sie spielt in alphabetischer Reihenfolge vor, was ein Auge ist, was ein Buch und was ein Daumen, das C lässt sie wegfallen, vom Auge und vom Daumen kommt sie auf die Umlaute zu sprechen, au, eu, ei, vom ei kommt sie auf das lange ie, hi-i-i-i-ier, sagt sie und begleitet mit der Hand die viele Luft, die bei einem so langen Laut aus ihrem Mund kommt. Während sie unterrichtet, bleiben die Türen offen. Von Zeit zu Zeit kommt noch ein verspäteter Schüler, von Zeit zu Zeit packt einer seine Sachen wieder zusammen, entschuldigt sich und geht mitten im Unterricht fort. In der letzten halben Stunde macht die junge Lehrerin für diejenigen, die schon fortgeschrittener sind, Übungen zu den Hilfsverben haben und sein . Ich gehe, sagt sie und geht ein paar Schritte mit angewinkelten Armen von rechts nach links, dann zeigt sie nach hinten über ihre Schulter, dorthin, wo die Vergangenheit ist, und sagt: Gestern bin ich gegangen. Sagt: Verben der Fortbewegung brauchen meistens das Hilfsverb sein . Ich bin, du bist, er ist und so weiter. Ich bin gegangen, bin geflogen, bin geschwommen. Sie marschiert nun wieder zurück mit angewinkelten Armen, sie breitet die Arme zum Fliegen aus, sie schwimmt an der Tafel vorüber. Ich bin super, sagt plötzlich Apoll. Jaja, sagt sie, du bist super, aber wir wollen jetzt die Vergangenheit bilden.
Als der Unterricht zuende ist, gehen die Männer an Richard vorbei hinaus, ein paar nicken ihm zu: Zair? Der lange Ithemba? Apoll gibt ihm die Hand, auch Tristan, wie geht’s, I’m fine, wie geht’s, I’m okay, I’m a little bit fine.
Sie sind eine gute Lehrerin, sagt er zu der Äthiopierin, als die Männer fort sind.
Und hübsch ist sie, denkt er.
Eigentlich habe ich Landwirtschaft studiert, sagt sie und packt ihre auf Pappe gemalten Buchstaben wieder ein, es weiß nur niemand, wann der vom Senat versprochene Deutschunterricht in einer richtigen Schule endlich anfangen wird.
Sehr hübsch.
Nach Marihuana habe es auf dem Oranienplatz gerochen. Und da habe sie gewusst, dass etwas getan werden müsse, bevor diesen Männern alles für immer entgleite.
Ob die einen schwarzen Mann will und nur deshalb hier unterrichtet?
Ihre Zeit muss mit irgendetwas gefüllt sein, sagt sie.
Ihre Zeit? Einen kurzen Moment lang ist er verwirrt, weil er glaubt, sie spreche ihn an. Dabei, wird ihm dann sofort klar, kann es nur das Possessivpronomen für die 3. Person Plural sein, das die junge Frau hier auf die Männer bezieht.
Verstehe.
Wenn man verstehen will, was einer meint oder sagt, muss man im Grunde das, was er meint oder sagt, immer schon wissen. Ist dann ein gelungener Dialog nur ein Wiedererkennen? Und das Verstehen nicht etwa ein Weg, sondern vielmehr ein Zustand?
Die Lehrerin schließt jetzt die Fenster, dabei reckt sie sich und ihre Brüste werden ganz flach. Von den Holzrahmen rieselt trockene weiße Farbe zu Boden.
Mit seinen Studenten war er über solchen Fragen immer ganz schnell bei ganz anderen Themen gelandet: beim Fortschrittsbegriff, bei der Frage danach, was Freiheit eigentlich sei, und beim Vier-Seiten-Modell, das beschreibt, dass Sprechen immer auch Taktik ist und grundsätzlich einen doppelten Boden hat, weil es immer auch über sich selbst spricht, darüber nämlich, dass es da ist oder nicht da ist, das Sprechen, und genauso versteht der andere immer viel mehr als nur Worte, immer ist im Zuhören die Frage enthalten: Was soll man verstehen, was will man verstehen, und was wird man nie verstehen, will es aber bestätigt bekommen.
Die Heizung lässt sich nicht abstellen, sagt die Lehrerin.
Wie lange unterrichten Sie schon?
Im Sommer habe ich angefangen, da waren die Männer noch auf dem Platz. Das Lernen beschäftigt sie auch in der Zeit jenseits der Unterrichtsstunden, das ist das Gute. Aber manchmal fehlt ihnen die Konzentration.
Die Lehrerin wischt von der Tafel, was darauf geschrieben steht: Auge, Buch, Daumen.
Die Aussprache ist vielleicht ungewohnt, sagt er, und dann die unregelmäßigen Verben.
Das ist nicht der Grund. Es gibt so viel Unruhe im Leben der Männer, da ist im Kopf kein Platz für Vokabeln. Sie wissen nicht, was mit ihnen werden soll. Sie haben Angst. Es ist schwer, eine Sprache zu lernen, wenn man nicht weiß, wozu.
Wie lange schon war er nicht mehr mit einer Frau beisammen?
Was diese Männer, um zur Ruhe zu kommen, unbedingt brauchen, ist Frieden, sagt sie.
So hat er das noch nie gesehen: Dass das, was ihm hier Frieden zu sein scheint, für diese Männer, solange sie nicht ankommen dürfen, im Prinzip immer noch Krieg ist.
Die Lehrerin nimmt ihre Tasche, er schiebt seinen Stuhl zurück an den Tisch.
Machen Sie bitte, bevor Sie gehen, das Licht aus? Und schon hat sie Wiedersehen gesagt und ist draußen. Sie ist schnell, das gefällt ihm.
Dieses ewig flackernde Neonlicht, das die Taghelle aufweicht.
Aus.
Beim Blick über die Schulter sieht der Saal jetzt wirklich sehr leer aus. Jungfrau Astraia, der Himmlischen Letzte , hat ihn verlassen. Diese Tische, an denen er und die Flüchtlinge eben noch saßen, sind, erst jetzt wird ihm das klar, tatsächlich zu klein für erwachsene Schüler. Ausrangierte Tische sind das aus einer Schule für Kinder, wahrscheinlich aus der Polytechnischen Oberschule Johannes R. Becher , die jetzt Grundschule am See heißt. Der Dichter Johannes R. Becher hat den Text der DDR-Nationalhymne geschrieben und ist später Kulturminister gewesen. An der Seite der Tische sieht Richard noch die Haken für die Ranzen der Schüler von vor dreißig Jahren, der jungen Pioniere, die inzwischen längst Verkäuferin, Ingenieur oder arbeitslos sind, ein- oder zweimal geschieden, null bis vier Kinder. Die Stühle sind zusammengewürfelt, manche mit gelbem, manche mit weinrotem Polster, manche aus Holz, andere aus Metall. Er kennt diese Stühle gut. Stühle aus der Zeit der Parteiversammlungen, der Wohngebietsclubs, der Betriebsfeiern zum Jahrestag der Republik. Überall, wo der Westen Einzug hielt, wurde als erstes dieses sozialistische Mobiliar auf den Müll geworfen. Und sogar jetzt, bald fünfundzwanzig Jahre nach der sogenannten Wiedervereinigung , kann man noch manchmal, wo geräumt und gebaut wird, aus Sperrmüllcontainern die ineinander verhakten Beine dieser aus der Mode gekommenen, immer in großen Mengen auftretenden, hölzernen oder graubeinigen Stühle ragen sehen. Seine Mutter hätte gesagt: Die sind doch noch gut. Diesen Satz hat er schon lange nicht mehr gehört. Vielleicht hätte er heute das hellblaue Hemd anziehen sollen.
Читать дальше