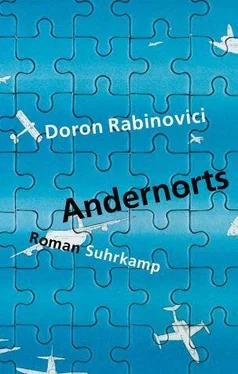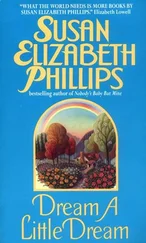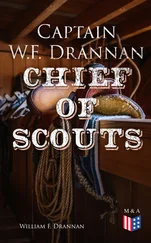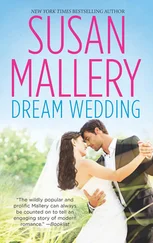«Wie Sie meinen.«
«Ich meine gar nichts. Ich folge bloß den Richtlinien des Projekts und den Geboten des Herrn.«
Auf dem Gang warteten sie, bis sie in ein Zimmer gebeten wurden. Sie mußten ein Formular ausfüllen und ein Papier unterschreiben. Jeder von ihnen erhielt einen Plastikbecher. Sie sollten zunächst in die Muschel urinieren, dann innehalten, den Strahl in den Becher lenken und den Rest wieder in die Muschel ablassen. Ethan ging als erster auf die Toilette. Danach mußten sie den Arm frei machen, und ihnen wurde Blut abgenommen. Ethan sah zur Seite, als die Nadel die Haut durchstach. Rudi lächelte die kleine, schlanke Schwester aufmunternd an.
Er war von Anfang an nur einverstanden gewesen, sich auf das Projekt des Rabbiners einzulassen, wenn untersucht würde, ob einer von ihnen beiden für eine Transplantation in Frage käme. Falls keine andere Niere gefunden wurde, sollte auf sie beide zurückgegriffen werden, und er hoffte insgeheim auf diesen Notfall. Eine junge Assistenzärztin sagte ihnen, beim nächsten Termin in einer Woche sei, falls die Untersuchungen keine Unregelmäßigkeiten anzeigten, die Spermienspende vorgesehen. Sie sollten vier Tage davor Abstinenz üben. Kein Samenerguß.
Draußen prügelte die Sonne auf sie ein. Ethan fragte:»Du willst Jude werden? Samt Beschneidung?«
«Ja, weil ich mich als Jude fühle.«
«Na, dann. Wenn du es ohnedies schon bist. Wozu noch übertreten? Was brauchst du den Segen der Rabbiner? Oder glaubst du etwa an Gott?«
«Nein. Nur wenn es unbedingt sein muß…«
Ethan verzog den Mund. Er verbarg sein Mißtrauen nicht. Wie verlockend, ein Opfer sein zu dürfen, ohne je gelitten zu haben. Sie trotteten nebeneinander her, verließen die Klinik durch den Hauptausgang.
Unvermittelt blieb Rudi stehen.»Wenn ich erklärte, ab morgen Hopi oder Sioux zu werden, würdest du es akzeptieren. Ich könnte mir einbilden, ein keltischer Druide zu sein, mir einen Helm mit Hörnern aufsetzen, und du würdest es pittoresk und lustig finden. Und was ist ein echter Hopi? Niemand läuft mehr mit Pfeil und Bogen durch die Prärie.«
Passanten starrten sie an. Ethan packte Rudi am Ärmel.»Ist schon gut«, murmelte er und zog ihn schnell weiter.
Ein Wechselbalg war er von Anfang an gewesen. Bei ihm war es nicht wie bei Kindern, die zuviel Karl May gelesen hatten und daraufhin mit Federschmuck durch den Park schlichen. Das Judenkind war er schon vor seiner Geburt gewesen. Seit es die Mär von Ahasver gab, seit er heimatlos durch die Welt geirrt war. So hatten ihn alle gesehen, die wußten, daß sein leiblicher Vater ein Überlebender war. Der Vater war sein schwarzer Fleck. Der Schattenriß mit Krummnase. Mama wollte nichts von ihm wissen. Nichts von ihrer einstigen Liebe, aber auch nicht viel von ihrem Sohn. Er war kein Wunschbaby gewesen, sondern Ausdruck ihrer Verzweiflung. Seine Geburt als ihre Niederlage. Der Geliebte hatte längst für seine Ehe optiert. Einige Jahre später hätte die Mama ihn wohl abgetrieben. Unter ärztlicher Obhut und straffrei. Aber damals…
Ob sie es nicht dennoch versucht hatte? In der Oberstufe stellte sich Rudi diese Frage. Aber da hatte sie ihn schon fortgebracht zu den Ersatzeltern. Sie winkte zum Abschied. Nicht ohne Tränen in den Augen. Galten die ihm oder ihr selbst?
In der Pflegefamilie sollte er sich gefälligst fühlen wie zu Haus, und der Mutter in Wien und der Tiroler Mama durfte er keinen Kummer bereiten. Er sollte sich einleben. Am Sonntag in die Kirche gehen. Der Pfarrer warnte die Buben davor, das Spatzerl in die Hand zu nehmen. Wer sein Glied anfaßt, der komme in die Hölle, hieß es, und da wußte Rudi wochenlang nicht, wie er auf dem Klo in die Hose fahren solle, um dieses Teil da hervorzuziehen. Aber so spitzfingrig er es auch anfaßte, das Judenkind blieb er ohnedies. Die Welt war voll mit Menschen, die Juden, Orientalen oder Südseeinsulaner sein wollten und sich und ihr Zuhause exotisch ausstaffierten. Räucherstäbchen versüßten die Luft. Im Hinterhof bauten sie ein Nomadenzelt auf. Sie setzten eine Baskenmütze auf, ließen sich einen Schnurrbart wachsen und tranken Milchkaffee aus der Müslischale, um sich französisch zu fühlen. Sie tanzten Flamenco, weil ihnen ihr Heim nur noch spanisch vorkam. Warum auch nicht? Wieso sollte es lächerlicher sein, am Wörther See einen Sarong zu tragen als eine Lederhose? Sah etwa ein Kilt in Paris possierlicher aus als in Edinburgh?
Er aber, der sich in vielen Staaten und Sprachen eingelebt hatte, mußte sich nicht kostümieren. Im Internat galt er bald als Experte fürs Judentum. Sein Vater, der nie dagewesen war, hatte ihn geprägt. Durch Abwesenheit. Rudi hatte Judaistik, Jiddisch und Hebräisch studiert. Er wußte mehr über Thora und Talmud als viele, die in jüdischen Familien aufwuchsen. Er kannte die Gebete und Gebote.
Bei ihm war es keine Laune, wenn er sagte, übertreten zu wollen. Andere mochten sich maskieren, wenn sie konvertierten. Er schminkte sich ab. Israelis wie Ethan waren in Zion geboren, doch am liebsten lebten sie andernorts, in New York, San Francisco oder London, in Paris, Berlin oder Rom. Ethan gefiel das Land am besten, wenn es weit weg war. Im Taxi sagte er zu Rudi:»Ich warne dich. Das Judentum ist eine Alterserscheinung. Diese Jungen, die zunächst mit freiem Antlitz und frischen Ansichten in die Welt stürmen, werden irgendwann müde, und ihre Gesichter zerfließen, ihre Nasen werden länger, und ihre Augen trüben sich ein, bis alle meinen, sie schauten abgeklärt. So werden sie zu alten Juden. Und sie, die nie an Gott glaubten, die über Koalition und Armee lästerten, die jeden Freitag in die Disco und in die Bar liefen, die Nächte durchmachten und Joints rauchten, zünden unversehens am Schabbath die Kerzen an, segnen Brot und Wein — alles wegen der Kinder, sagen sie zunächst — , und dann beginnen sie auf einmal die überkommenen Ressentiments und ihre eingefleischten Ängste zu lieben. Ängste, von denen niemand ahnte, daß sie die überhaupt haben. Ängste, vor denen sich alle anderen fürchten müssen.«
Rudi schüttelte den Kopf. Er fühlte sich hier verjüngt. Tel Aviv — wenn er durch diese Straßen ging, war ihm, als wären alle, die ihm entgegenkamen, Büchern entsprungen. Sie redeten Hebräisch, Jiddisch, Französisch, Russisch, Englisch, Polnisch, Deutsch, Italienisch, Amharisch oder Arabisch. Und da waren auch noch die papierlosen Zuwanderen Sie sprachen Filipino, Rumänisch, Mandarin, Yoruba oder auch Igbo.
Eines Tages war er durch eine schmale Gasse gegangen, die parallel zur Strandpromenade lief, dann im rechten Winkel abbog, um in die Dizengoff, die rastlose Geschäftsstraße, zu münden. In diesem engen Durchfahrtsweg zwischen den alten Bauhausgebäuden war es mit einemmal ganz still. Eine Katze strich eine Mauer entlang, irgendwo Vogelgezwitscher und plötzlich von einem kleinen Balkon im ersten Stock die unverkennbare Stimme von Lotte Lehmann. Sie sang eines ihrer Lieblingslieder, den Gesang Weylas. Zunächst das leise Wogen des Klaviers, dann die ersten Worte. Du bist Orplid, mein Land! Die Hymne auf ein Land der Sehnsucht, auf einen Ort, der nah und fern zugleich war, und dann sah Rudi einen alten Mann im kurzärmeligen Hemd, mit dicker Hornbrille und schlohweißem Haar, eine greisenhafte Gestalt, die auf der Veranda saß und stumpf vor sich hin blickte. War er noch mit der Schallplatte im Gepäck hierher entkommen? Dachte er jetzt zurück an die einstige, die unrettbar verlorene Heimat? Im Tel Aviv der dreißiger und vierziger Jahre war Deutsch aus den Straßen und Kinos verbannt worden. Bei manchen deutschen Filmen war als Sprache Österreichisch angegeben worden, um keinen Unmut zu provozieren. Du bist Orplid, mein Land! / Das ferne leuchtet. Lehmanns Gesang gewann an Kraft. Die Musik steigerte sich zum Crescendo. Vom Meere dampfet dein besonnter Strand / Den Nebel, so der Götter Wange feuchtet. Rudis Hemd klebte an der Haut. Die Mittagshitze war unerträglich. Die Stadt brodelte. Sie war weit weg und doch nur hinter der nächsten Ecke. Uralte Wasser steigen! Verjüngt um deine Hüften, Kind!
Читать дальше