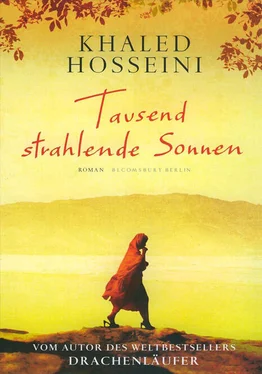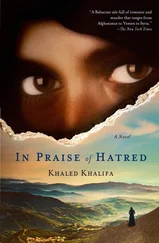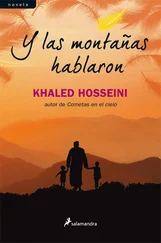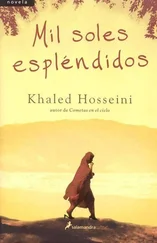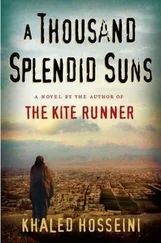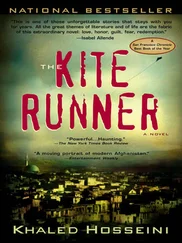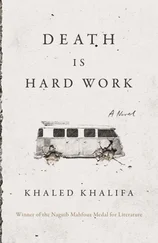Das schrille Pfeifen von Raketen weckte sie auf. Irgendwo am Himmel, den sie nicht sah, loderte Feuerschein auf. Das hektische Rattern von Maschinengewehren war zu hören. Laila schloss die Augen. Sie wachte wieder auf, als Raschid durch den Flur stampfte, schleppte sich zur Tür und schlug mit der flachen Hand dagegen.
»Nur ein Glas Wasser, Raschid. Nicht für mich. Für sie.
Du willst dich doch nicht an ihr versündigen.«
Er ging vorüber.
Sie flehte ihn an, bettelte um Vergebung, machte Versprechungen. Sie verfluchte ihn.
Die Tür zu seinem Zimmer fiel ins Schloss. Das Radio wurde eingeschaltet.
Der Muezzin rief zum dritten Mal den athan. Wieder diese Hitze. Aziza wurde schwächer und schwächer. Sie bewegte sich kaum noch und weinte auch nicht mehr.
Laila führte immer wieder ihr Ohr über den Mund der Kleinen und lauschte, jedes Mal voller Angst, sie könnte zu atmen aufhören. Sich aufzurichten machte sie schwindeln und war ihr bald zu viel. Sie schlief ein und hatte einen Traum, an den sie sich nach dem Erwachen nicht erinnern konnte. Sofort tastete sie mit der Hand nach Aziza, deren trockene Lippen aufgesprungen waren. Als sie sich davon überzeugt hatte, dass ihr Puls an der Halsschlagader noch zu erfühlen war, legte sie sich wieder hin. Dass sie hier sterben würde, schien ihr nunmehr festzustehen, aber was sie noch mehr schreckte, war, dass sie ihre Tochter, die ja so viel schwächer war, überdauern würde. Wie lange mochte Aziza noch aushalten? Sie würde dieser Hitze bald erlegen sein und ihr kleiner Körper erstarren, während sie, ihre Mutter, auf den eigenen Tod wartete. Wieder schlief sie ein. Wachte auf. Schlief ein. Die Grenze zwischen Traum und wachem Bewusstsein verwischte.
Es war weder der athan noch ein krähender Hahn, der sie diesmal weckte, sondern das Geräusch eines schweren Gegenstandes, der vor der Tür zur Seite geschoben wurde. Sie hörte ein Klappern, und plötzlich flutete Licht ins Zimmer, das ihr in den Augen schmerzte. Laila hob den Kopf und schlug wimmernd eine Hand vor die Augen. Durch einen Spalt zwischen den Fingern sah sie eine große verschwommene Silhouette im gleißend hellen Ausschnitt der Tür. Der Schatten rückte näher. Dann beugte sich eine Gestalt über sie. Eine Stimme drang an ihr Ohr.
»Solltest du es noch mal versuchen, werde ich dich finden. Ich schwöre beim Namen des Propheten, dass ich dich finden werde. Und in diesem gottverdammten Land wird es keinen Richter geben, der mich dafür büßen ließe, was ich dann tun werde. Zuerst mit Mariam, dann mit ihr und zuletzt mit dir. Ich werde dich zwingen, dabei zuzusehen. Verstehst du mich? Du würdest es mit eigenen Augen sehen.«
Dann verließ er das Zimmer, nicht ohne ihr vorher noch einen Tritt in die Seite zu versetzen, der dazu führte, dass Laila tagelang Blut ausscheiden sollte.
Mariam
September 1996
Am frühen Morgen des 27. September — zweieinhalb Jahre nach ihrer gescheiterten Flucht — wurde Mariam von Rufen und schrillen Pfiffen, Musik und dem Krachen von Feuerwerkskörpern geweckt. Sie lief ins Wohnzimmer und sah Laila mit Aziza auf den Schultern vorm Fenster stehen. Sie drehte sich um und lächelte.
»Die Taliban sind da«, sagte sie.
Zum ersten Mal hatte Mariam im Oktober 1994 von den Taliban gehört, als Raschid mit der Nachricht nach Hause gekommen war, dass diese die Kriegsherren aus Kandahar vertrieben und die Stadt eingenommen hätten. Er hatte sie als Partisanen bezeichnet und erklärt, dass es sich bei ihnen um junge Paschtunen handele, deren Familien während des Krieges gegen die Sowjets nach Pakistan geflohen waren. Die meisten von ihnen seien in den Flüchtlingslagern an der pakistanischen Grenze aufgewachsen — oder auch zur Welt gekommen — und in den dortigen madrasas, den Koranschulen, von Mullahs in Islamischem Recht unterwiesen worden. Ihr Anführer Mullah Omar, sagte Raschid halb amüsiert, sei ein mysteriöser einäugiger Analphabet, der sehr zurückgezogen lebe und sich selbst Amir al-Muminin nenne, Führer der Gläubigen.
»Es stimmt, diese Burschen haben keine risha, keine Wurzeln«, sagte Raschid, ohne dass er Mariam oder Laila direkt angesprochen hätte. Seit der gescheiterten Flucht waren Mariam und Laila für ihn ein und dasselbe, gleichermaßen erbärmlich, verabscheuenswert und seiner nicht würdig. Wenn er sprach, hatte Mariam den Eindruck, dass er mit sich selbst redete oder mit irgendeiner unsichtbaren Person, die im Unterschied zu ihr und Laila seine Ansprache verdiente.
»Vielleicht haben sie ja keine Vergangenheit«, sagte er und blies Zigarettenrauch unter die Zimmerdecke. »Mag sein, dass sie von der Welt und der Geschichte dieses Landes keine Ahnung haben. Ja. Und verglichen mit ihnen könnte Mariam womöglich glatt als Universitätsprofessorin durchgehen. Ha! So ist es wohl. Aber schaut euch um. Was seht ihr? Korrupte, gierige Mudschaheddin-Kommandeure, die bis an die Zähne bewaffnet sind, sich am Heroinschmuggel bereichern, untereinander Krieg führen und alles niedermachen, was ihnen in die Quere kommt. So sieht’s doch aus. Die Taliban dagegen sind immerhin sauber und unbestechlich. Anständige Muslime. Wallab, wenn sie kommen, wird aufgeräumt. Sie werden für Frieden und Ordnung sorgen. Dann muss man nicht mehr fürchten, beim Milchholen erschossen zu werden, und mit den Raketen ist es vorbei. Das wär doch was.«
Seit nunmehr zwei Jahren drängten die Taliban die Mudschaheddin immer weiter zurück, besetzten eine Stadt nach der anderen und machten den Kämpfen zwischen den zerstrittenen Fraktionen ein Ende. Sie hatten Ismael Khan, den Kriegsherrn von Herat, zur Flucht in den Iran gezwungen, den Hazara-Kommandeur Abdul Ali Mazari gefangen genommen und hingerichtet. Seit Monaten schon hielten sie Vororte im Süden Kabuls besetzt und lieferten sich Artilleriegefechte mit Ahmad Schah Massoud. Anfang September dieses Jahres hatten sie die Städte Jalalabad und Sarobi eingenommen.
Die Taliban hätten den Mudschaheddin gegenüber einen entscheidenden Vorteil, erklärte Raschid. Sie seien sich einig.
»Sollen sie kommen«, sagte er. »Ich für mein Teil werde ihnen Rosenblätter auf den Weg streuen.«
Sie gingen aus an diesem Tag, alle vier. Raschid fuhr mit ihnen im Bus durch die Stadt, um ihre neue Welt und ihre neuen Anführer zu begrüßen. Überall sah Mariam aus den Ruinen zerschossener Häuser Gestalten in Erscheinung treten. Sie sah eine alte Frau, die aus vollen Händen Reis über Passanten streute und lachend ihren zahnlosen Mund dabei öffnete. Zwei Männer lagen sich vor einem verwüsteten Gebäude in den Armen, und am Himmel zischten und zerplatzten Feuerwerkskörper, die junge Burschen von Hausdächern aus abfeuerten. Aus Lautsprechern tönte die Nationalhymne in Konkurrenz mit dem Gehupe der Autos.
»Sieh mal da, Mayam!«, rief Aziza und zeigte auf eine Gruppe von Jungen, die die Jadeh Maywand entlangliefen. Sie schwangen ihre Fäuste, zogen verrostete Konservendosen an Schnüren hinter sich her und brüllten, dass Massoud und
Rabbani aus Kabul abgezogen seien.
Ringsum erschallte der Ruf Allah-u-akbar.
Vor einem Fenster an der Jadeh Maywand hing ein weißes Bettlaken, auf dem in großen schwarzen Druckbuchstaben geschrieben stand: Zenda Baad Taliban. Lang leben die Taliban.
Während sie durch die Straßen fuhren, entdeckte Mariam weitere solcher Willkommensgrüße — auf Schaufenster gemalt, auf Schilder, die an Türen genagelt waren, oder auf Fähnchen, die an Autoantennen flatterten.
Ein paar Stunden später bekam Mariam schließlich auch die gefeierten Helden leibhaftig zu Gesicht, nämlich am Paschtunistan-Platz, den sie mit Raschid, Laila und Aziza aufsuchte. Eine große Menschenmenge hatte sich um den blauen Brunnen in der Mitte des Platzes versammelt. Mariam sah, wie alle die Hälse reckten und den Blick auf das alte Khyber-Restaurant am Rand des Platzes richteten.
Читать дальше