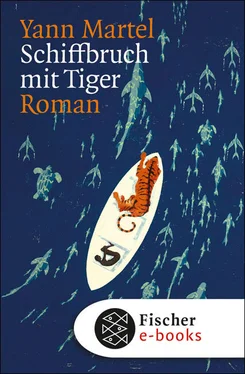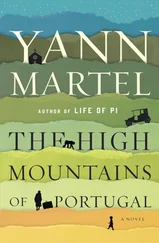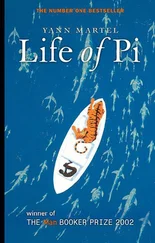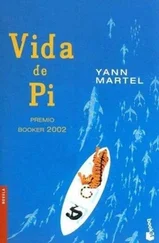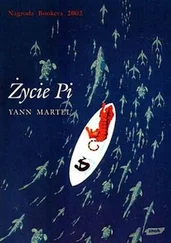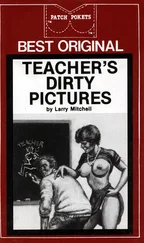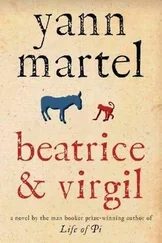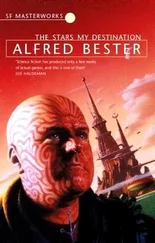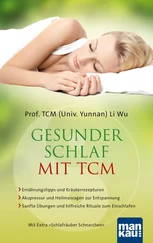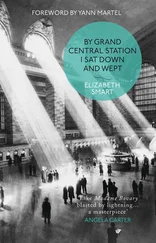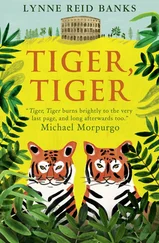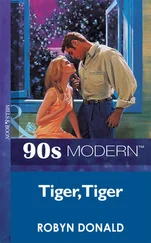Verzweiflung war ein ewiges Dunkel, in das kein Lichtstrahl drang. Eine namenlose Hölle. Ich danke Gott, dass sie jedes Mal wieder verging. Ein Schwarm Fische näherte sich dem Netz oder ein Knoten löste sich und musste neu geknotet werden. Oder ich dachte an meine Familie, daran, dass ihnen diese entsetzlichen Leiden erspart geblieben waren. Das Dunkel hob sich, und schließlich war es fort, aber Gott blieb, ein Licht in meinem Herzen. Ich würde weiterlieben.
Kapitel 75
An dem Tag, der nach meiner Berechnung Mutters Geburtstag sein musste, sang ich laut »Happy Birthday« für sie.
Kapitel 76
Ich gewöhnte mir an, bei Richard Parker sauber zu machen. Sobald ich merkte, dass er seinen Darm entleert hatte, beseitigte ich es, eine gefährliche Unternehmung, bei der ich den Kot mit dem Fischhaken zu mir heranscharrte und dann auf die Plane holte. Fäkalien können mit Parasiten infiziert sein. Das spielt für frei lebende Tiere keine Rolle, denn sie bleiben in der Regel nicht in der Nähe dieser Fäkalien und kümmern sich nicht weiter darum; Baumbewohner bekommen ihren Kot kaum zu Gesicht, und Landtiere entleeren sich und ziehen dann weiter. Für das kompakte Territorium eines Zoos gelten hingegen andere Regeln, denn wenn man Fäkalien im Gehege eines Tieres liegen lässt, ermuntert man es geradezu, diese zu fressen und sich damit zu infizieren; Tiere verschlingen alles, was auch nur entfernt nach Nahrung aussieht. Deshalb werden die Gehege ständig gereinigt, aus Sorge um die Gesundheit ihrer Bewohner, nicht aus Rücksicht auf Augen und Nasen der Besucher. Aber nicht um den hohen zoohygienischen Standard der Familie Patel zu halten, räumte ich bei Richard Parker auf. Nach wenigen Wochen litt er ohnehin so sehr an Verstopfung, dass sein Darm sich nur noch einmal im Monat entleerte, und meine riskante Pflegerarbeit wäre aus Gesundheitsgründen nicht notwendig gewesen. Es steckte etwas anderes dahinter: Als Richard Parker sich das erste Mal im Rettungsboot Erleichterung verschafft hatte, war mir aufgefallen, dass er versuchte, den Haufen zu verscharren. Die Bedeutung dieser Geste war mir nicht verborgen geblieben. Den Kot offen liegen zu lassen, sodass jeder ihn roch, wäre ein Zeichen der Dominanz gewesen. Ihn zu verscharren oder es zumindest zu versuchen, bedeutete Unterwerfung - er unterwarf sich mir .
Dass es ihn nervös machte, war nicht zu übersehen. Er stand geduckt, den Kopf eingezogen, die Ohren flach angelegt, und stieß ein leises langgezogenes Knurren aus. Ich ging energisch und zielstrebig zu Werke, nicht nur um mein Leben zu schützen, sondern auch, damit ich ihm möglichst schnell das erforderliche Signal gab. Dieses Signal bestand darin, dass ich den Kot in die Hand nahm, ihn einige Sekunden lang hin- und herrollte, ihn mir unter die Nase hielt und hörbar daran schnüffelte, und dabei starrte ich den Tiger ein paar Mal theatralisch an, die Augen weit aufgerissen (vor Furcht, aber das durfte er nicht merken), und das lang genug, dass es ihn ordentlich einschüchterte, aber nicht so lang, dass er sich auf mich stürzte. Und jedes Mal, wenn ich ihn so ansah, blies ich leise drohend auf meiner Pfeife. Indem ich ihm derart mit den Augen zusetzte (denn natürlich ist bei allen Tieren, uns Menschen eingeschlossen, das Anstarren ein Akt der Aggression) und indem ich jenen Pfeifton produzierte, mit dem er in Gedanken so unangenehme Gefühle verband, machte ich Richard Parker klar, dass es mein Recht war, mein Recht als Souverän, seinen Kot in die Hand zu nehmen und daran zu schnüffeln, wenn mir danach war. Nicht die Sorge des Zoowärters trieb mich also an, sondern angewandte Psychologie. Und es funktionierte. Richard Parker starrte nie zurück; er hielt den Blick stets in mittlerer Entfernung, nicht auf mich gerichtet, aber auch nicht von mir abgewandt. Es war etwas, das ich spüren konnte, so wie ich die Kugel in meiner Hand spürte: So entstand Macht. Nach der Anspannung dieser Übung war ich stets schwer erschöpft, aber glücklich.
Wo wir schon bei dem Thema sind: Ich war bald genauso verstopft wie Richard Parker. Das lag an unserer Ernährung, zu wenig Wasser, zu viel Protein. Auch bei mir kam die Entleerung des Darms nur noch einmal im Monat, und eine Erleichterung war es nicht. Es war ein langer, mühsamer und schmerzlicher Kampf, an dessen Ende ich schweißgebadet und bis zur Hilflosigkeit ermattet dalag, eine Tortur, die schlimmer war als das höchste Fieber.
Kapitel 77
Als die Päckchen mit den Notrationen zusehends schwanden, aß ich immer weniger, bis ich schließlich genau den Anweisungen folgte und nur noch alle acht Stunden zwei Zwiebacke zu mir nahm. Ich war ständig hungrig. Ich dachte nur noch an Nahrung. Je weniger ich zu essen hatte, desto größer wurden die Portionen, von denen ich träumte. Die Mahlzeiten meiner Phantasie waren so groß wie ganz Indien. Ströme von roter Linsensuppe so mächtig wie der Ganges. Chappatis so groß wie Rajasthan. Reisschüsseln so riesig wie Uttar Pradesh. Sambars, die ganz Tamil Nadu überflutet hätten. Berge von Eiscreme so hoch wie der Himalaja. In meinen Träumen war ich ein wahrer Meisterkoch: Alle Zutaten waren stets frisch und in Hülle und Fülle vorhanden, Backofen oder Bratpfanne hatten immer genau die richtige Temperatur, alles war sorgsam aufeinander abgestimmt, nichts war je angebrannt oder noch halbroh, nichts zu heiß oder zu kalt. Jede Mahlzeit war einfach perfekt - zum Greifen nah und doch unerreichbar für mich.
Im Laufe der Zeit entdeckte ich immer neue Nahrungsquellen. Anfangs hatte ich die Fische noch ausgenommen und ihnen sorgsam die Haut abgezogen, doch bald streifte ich nur noch den glitschigen Schleim von den Schuppen, dann biss ich hinein, und es schien mir der größte Leckerbissen. Ich weiß noch, dass Fliegende Fische durchaus schmackhaft waren, zart und rosa-weiß. Doraden hatten festeres Fleisch und einen intensiveren Geschmack. Ich nagte nun Fischköpfe ab, statt dass ich sie Richard Parker vorwarf oder als Köder nahm. Dabei machte ich eine großartige Entdeckung: Ich stellte fest, dass nicht nur die Augen größerer Fische, sondern auch ihre Wirbelsäule eine erfrischende Flüssigkeit enthielten. Schildkröten - die ich zuvor nur hastig mit dem Messer geöffnet und achtlos für Richard Parker auf den Boden des Bootes geschleudert hatte wie eine Schale mit heißer Suppe - wurden jetzt mein Leibgericht.
Man mag es kaum glauben, dass es eine Zeit gab, in der ich eine Meeresschildkröte als Delikatesse, als köstliches zehngängiges Menü betrachtete, eine ersehnte Abwechslung vom ewigen Fisch. Doch genau so war es. In den Adern der Schildkröten strömte ein süßes Lassi, das getrunken werden musste, sobald es aus ihrem Hals sprudelte, denn es gerann binnen Sekunden. Selbst die köstlichsten Poriyals und Kootus von ganz Indien konnten es nicht mit Schildkrötenfleisch aufnehmen, ob nun braun und getrocknet oder frisch und dunkelrot. Nie hatte ich ein Kardamom-Payasam gekostet, so süß und so cremig wie Schildkröteneier oder getrocknetes Schildkrötenfett. Eine Mischung aus gehacktem Herz, Lunge, Leber, Fleisch und gereinigten Därmen, bestreut mit Fischstückchen und getränkt mit einer Soße aus Dotter und Blutserum ergab ein unvergleichliches Thali, nach dem ich mir die Finger leckte. Am Ende meiner Reise aß ich alles, was eine Schildkröte zu bieten hatte. In dem Algenbewuchs auf dem Panzer mancher Karettschildkröten entdeckte ich hin und wieder kleine Krebse und Entenmuscheln. Was immer ich im Magen einer Schildkröte fand, wanderte in den meinen. So manche Stunde verbrachte ich mit glücklichem Nagen an einem Flossengelenk, oder ich leckte das Mark aus gespaltenen Knochen. Und meine Finger zupften unablässig an den winzigen Fettresten und trockenen Fleischfasern, die an der Innenseite der Schildkrötenpanzer klebten - wie bei einem Affen waren meine Finger automatisch immer auf der Suche nach Nahrung.
Читать дальше