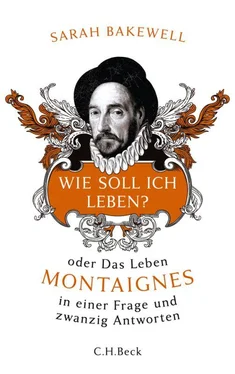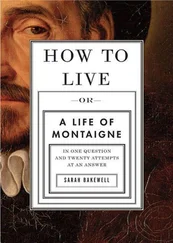Nicht jedem ist es vergönnt, geistig krank zu sein, aber jeder Mensch kann sich das Leben einfacher machen, indem er den Lichtstrahl der Vernunft ein wenig umlenkt. Besonders in Zeiten der Trauer jedoch erkannte Montaigne, dass Ablenkung seinen Schmerz nicht lindern konnte. Er versuchte es mit stoischen Tricks und schreckte auch nicht davor zurück, sich so intensiv auf La Boéties Tod zu konzentrieren, dass er schließlich einen Bericht über sein Sterben verfasste. In der Regel allerdings fand er es hilfreicher, seine Aufmerksamkeit auf andere Dinge zu lenken:
Ein quälender Gedanke bedrängt mich — und schon habe ich ihn ausgetauscht, denn das finde ich einfacher, als ihn zu bändigen: Kann ich ihn nicht durch einen gegenteiligen verdrängen, so zumindest durch einen andern. Jede Veränderung tut wohl und erleichtert, löst und zerstreut. Wenn ich aber den Gedanken nicht niederzukämpfen vermag, entwische ich ihm, und auf der Flucht schlage ich Haken und überliste ihn.
Derselben Methode bediente er sich auch anderen gegenüber. Als er einmal eine Frau zu trösten versuchte, die (anders als so manche Witwe, scheint er sagen zu wollen) aufrichtig um ihren verstorbenen Mann trauerte, erwog er zunächst die gängigen philosophischen Techniken: ihr klarzumachen, dass mit Klagen und Jammern nichts gewonnen sei, oder ihr einzureden, sie habe ihren Mann nie gekannt. Doch dann griff er zu einer anderen Taktik und lenkte «unser Gespräch ganz sanft, Schritt um Schritt erst auf die nächstliegenden Dinge, dann […] auf etwas weiter abliegende». Die Witwe schien dem zunächst wenig Aufmerksamkeit zu schenken, doch am Ende ließ sie sich ablenken. «Solcherart befreite ich sie, ohne dass sie es gewahr wurde, von ihren quälenden Gedanken und versetzte sie in einen ruhigen, völlig entspannten Zustand, der auch anhielt, solang ich bei ihr war.» Er wusste zwar, dass er damit ihren Kummer nicht aus der Welt geschafft hatte, trotzdem überwand sie auf diese Weise die akute Krise, und die Zeit tat ein Übriges.
Einige dieser Tricks kannte Montaigne aus seiner Lektüre der Epikureer, andere aus eigener bitterer Erfahrung. «Ich wurde einst von einem mächtigen Schmerz ergriffen», schrieb er, sicherlich mit Blick auf La Boétie. Der Tod des Freundes hätte ihn zerstört, wenn er nicht darauf vertraut hätte, dass die Kraft der Vernunft ihn rettete. Er erkannte, dass er «eine starke Ablenkung» brauchte, und beschloss, sich «nach allen Regeln der Kunst zu verlieben». Er sagt uns nicht, in wen, und es scheint wohl eine eher belanglose Affäre gewesen zu sein, aber sie entriss ihn seinem akuten Schmerz.
Ähnliche Tricks funktionierten auch bei einem anderen unwillkommenen Affekt: dem Zorn. Montaigne kurierte einmal einen «jungen Fürsten», wahrscheinlich Heinrich von Navarra, den späteren König Heinrich IV., von gefährlichen Rachegelüsten. Er redete ihm sein Gefühl nicht aus, er riet ihm auch nicht, die andere Wange hinzuhalten, noch führte er ihm die tragischen Folgen der Rache vor Augen, sondern er erwähnte die Rachegelüste überhaupt nicht.
Vielmehr ließ ich sie auf sich beruhn und ging eifrigst daran, ihm die Schönheit der entgegengesetzten Vorstellung schmackhaft zu machen: Welche Ehre nämlich, welchen Beifall und welches Wohlwollen er sich durch Milde und Güte erwerben könne. Ich lenkte also seinen Rachedurst auf die Ehrliebe ab. So muss man’s machen!
Später wandte Montaigne den Trick der Ablenkung an, um seine Angst vor Alter und Tod zu bekämpfen. Die Jahre brachten ihn dem Tod immer näher. Das war unausweichlich, und das einzige Mittel war, nicht nach vorne zu schauen. Also wandte er sich in die Vergangenheit zurück und gewann dadurch Trost, dass er voll Heiterkeit auf seine Kindheit und Jugend zurückblickte. Auf diese Weise, sagte er, sei es ihm gelungen, seinen Blick «von diesem wolken- und gewitterschweren Himmel [abzuwenden], der sich vor mir türmt.»
Er schätzte diese Techniken der Ablenkung so hoch ein, dass er sogar politische Taschenspielertricks bewunderte, solange sie nicht der Tyrannenherrschaft dienten. Er erzählte die Geschichte, auf welche Weise Zaleukos, der Fürst der Lokrer im alten Griechenland, überflüssigen Luxus in seinem Reich einschränkte. Er ordnete an, dass eine Dame nur dann mehrere Kammerfrauen in ihrem Gefolge haben dürfe, wenn sie betrunken ist, und dass sie so viel Goldschmuck und bestickte Gewänder tragen dürfe, wie sie wolle, aber nur, wenn sie als Prostituierte ihre Dienste feilbot. Ein Mann konnte Goldringe tragen, so viel er wollte — wenn er ein Zuhälter war. Und es funktionierte: Goldschmuck und große Gefolge waren über Nacht verschwunden. Niemand lehnte sich dagegen auf, weil niemand das Gefühl hatte, zu etwas gezwungen worden zu sein.
Aus seiner eigenen Erfahrung der Todesnähe hatte Montaigne gelernt, dass das beste Mittel gegen die Todesfurcht das Vertrauen in die Natur war: «Grübelt also nicht darüber nach.» Das galt auch für die Bewältigung der Trauer. Die Natur folgt ihrem eigenen Rhythmus. Der Trick, sich abzulenken, funktioniert, weil er der menschlichen Natur entspricht. «Im Augenblick des Todes denken wir stets an andres.» Es ist nur natürlich, dass wir uns ablenken lassen und damit sowohl vom Schmerz als auch vom Vergnügen «kaum auch nur deren äußerste Schale berühren». Wir müssen uns nur unserer Natur überlassen.
Seiner Lektüre der Stoiker und Epikureer entnahm Montaigne alles, was ihm hilfreich sein konnte, so wie seine Leser den Essais stets das entnahmen, was ihnen von Nutzen war, und den Rest einfach außer Acht ließen. Seine Zeitgenossen konzentrierten sich insbesondere auf die stoischen und epikureischen Passagen. Sie interpretierten sein Werk als Handbuch der Lebenspraxis und feierten ihn als einen Philosoph alten Stils, der es mit den Großen der Antike aufnehmen konnte. Sein Freund Étienne Pasquier nannte ihn «einen Seneca unserer Sprache». Florimond de Raemond, ein Freund und Kollege aus Bordeaux, lobte Montaignes Tapferkeit angesichts der Prüfungen des Lebens und riet den Lesern, vor allem in der Frage des Umgangs mit Tod und Sterben bei ihm Rat zu suchen. In einem Sonett, das 1595 zusammen mit einer Ausgabe der Essais veröffentlicht wurde, lobte Claude Expilly Montaigne als «großmütigen Stoiker» und fand lobende Worte für sein unerschrockenes Schreiben, seine Furchtlosigkeit und seine Fähigkeit, schwache Seelen zu stärken. Montaignes mutige Essais würden auch in den kommenden Jahrhunderten gerühmt werden, so Expilly, denn wie die antiken Autoren lehre auch Montaigne die Menschen, «wie man gut sprechen soll, gut leben, gut sterben».
Hier vermittelt sich schon eine Ahnung davon, welche Wandlungen Montaigne im Laufe der Jahrhunderte erleben würde, da jede Generation ihn als Quelle der Weisheit und Erleuchtung neu für sich entdeckte. Jede Generation fand bei ihm mehr oder weniger das, was sie erwartete, und oft auch das, was sie selbst hineinlegte. Montaignes erste Leser lebten in der Spätrenaissance, einer Epoche, in der Neostoiker und Neoepikureer sich mit der Frage nach dem rechten Leben beschäftigten und in einer leidvollen Welt nach eudaimonia strebten. Sie betrachteten ihn als einen der Ihren, machten sein Buch zu einem Bestseller und legten damit das Fundament für seinen Ruhm als pragmatischer Philosoph und als Lehrer der Lebenskunst.
Montaigne in der Knechtschaft
Dass Montaigne La Boétie in sich aufnahm wie einen guten Geist oder wie jemanden, der insgeheim an allem Anteil nimmt, was er tat, scheint seinem Plan zu widersprechen, sich von seiner Trauer abzulenken. Aber in gewisser Weise war auch dies eine Form der Ablenkung, die ihn vom Nachdenken über den erlittenen Verlust zu einer neuen Sichtweise des eigenen Lebens führte. Er konnte jetzt jederzeit von seinem eigenen Standpunkt zu dem Standpunkt wechseln, den La Boétie eingenommen hätte. Vielleicht brachte ihn das auf den Gedanken, dass wir, «wie soll ich sagen, in uns selber doppelt» sind.
Читать дальше