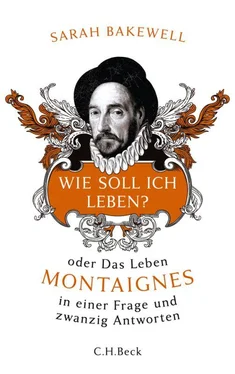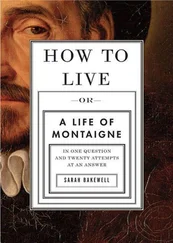Zu Lebzeiten La Boéties scheint Montaigne manchmal gegen dessen korrigierenden Einfluss aufbegehrt zu haben, davon war jetzt nichts mehr zu spüren. Nach dem Tod des Freundes konnte sich Montaigne ihm ohne Einschränkungen anheimgeben — und tun, worum La Boétie ihn gebeten hatte: ihm einen Platz einzuräumen.
Er nahm viele von La Boéties Büchern in seine Bibliothek auf und machte damit unter seinen Besitztümern Platz für seinen Freund. Er schrieb über La Boéties Sterben und Tod und rettete damit das Andenken des Freundes für die Nachwelt. Er bereitete mehrere seiner Schriften zur Veröffentlichung vor. Und als er sich schließlich aus dem öffentlichen Leben zurückzog, machte er den Freund zum Leitstern seiner neuen Lebensform. Der Inschrift, die er aus diesem Anlass an der Wand seiner Bibliothek anbringen ließ, fügte er eine weitere hinzu. Sie ist heute schwer zu entziffern, besagt aber, dass alle seine Bemühungen an dieser «Stätte des Studiums» seinem Freund gewidmet seien, «dem süßesten, liebsten und engsten Freund, […] wie unser Jahrhundert keinen besseren, gelehrteren und vollkommeneren gesehen hat». La Boétie sollte über Montaignes Tun in seiner Bibliothek wachen. Er sollte sein literarischer Schutzengel sein.
Mit seinem Tod verwandelte sich La Boétie von einem lebendigen und keineswegs tadellosen Gefährten Montaignes in ein Idealbild, das Montaigne vollkommen unter seine Kontrolle brachte. La Boétie war jetzt kein Mensch mehr, sondern eine philosophische Technik. Seneca hatte seinen Anhängern empfohlen, sich einen «hervorragend tüchtigen Mann als Muster» zu suchen und immer vor Augen zu haben, «um so zu leben, als schaue er auf uns, und immer so zu handeln, als hielte er seinen Blick auf uns gerichtet». Wer für sich selbst leben will, schrieb er, müsse für einen anderen leben, vor allem für den auserwählten Freund.
Montaigne war bereit, auf solche Tricks zurückzugreifen, wenn sie Trost versprachen. Wie er in einer seiner Widmungen anlässlich der Veröffentlichung von La Boéties nachgelassenen Schriften bekannte: «Er wohnt noch so ganz und so lebhaft bei mir, dass ich ihn weder so steif begraben noch so fern von unserem Dasein glauben kann.» La Boétie an seiner Seite weiterleben zu lassen war die Erfüllung des Wunsches, den der sterbende Freund noch hatte, und zugleich linderte es Montaignes eigene Einsamkeit. Dazwischen griff er zu Strategien der Zerstreuung und Ablenkung, um über den Verlust hinwegzukommen. Die beste Therapie jedoch war für ihn das Schreiben. Indem er die Schilderung von La Boéties Sterben der Nachwelt übermittelte, führte er sich selbst alles noch einmal vor Augen und bewältigte damit den Verlust. Ganz verwand er ihn nie, aber er lernte, ohne den Freund in dieser Welt zu leben, und änderte damit seine eigene Existenzform. Über La Boétie zu schreiben gab ihm schließlich den Anstoß, die Essais zu verfassen. Das war der beste philosophische Trick überhaupt.
6
Frage: Wie soll ich leben?
Antwort: Bediene dich kleiner Tricks!
Einübung in die Kunst des Lebens
Von der akademischen Philosophie hielt Montaigne nicht besonders viel, er hatte eine Abneigung gegen ihre Spitzfindigkeiten und Abstraktionen. Einer anderen philosophischen Tradition dagegen fühlte er sich sein Leben lang verbunden: den großen pragmatischen Schulen der antiken Philosophie, die sich mit praktischen Fragen der Lebensführung auseinandersetzten: wie man über den Tod eines Freundes hinwegkommt, wie man seinen Mut stärkt, wie man in einer moralisch schwierigen Situation recht handelt oder wie man aus seinem Leben das Beste machen kann. Das war die Philosophie, der er sich in Zeiten der Trauer oder Angst zuwandte und bei der er Hilfe im Umgang mit geringfügigeren Alltagsproblemen suchte.
Die drei bekanntesten dieser philosophischen Schulen waren Stoizismus, Epikureismus und Skeptizismus, jene Strömungen, die man kollektiv als hellenistische Philosophie bezeichnet. Ihre Wurzeln liegen im 3. Jahrhundert v. Chr., als sich das griechische Denken und die griechische Kultur nach Rom und in andere Regionen des Mittelmeers auszubreiten begannen. Sie unterscheiden sich in den Details, sind aber in ihren Grundelementen oft nur schwer auseinanderzuhalten. Und auch Montaigne bediente sich ihrer entsprechend seinen Bedürfnissen.
Alle diese Schulen hatten das Ziel der eudaimonia , oft übersetzt mit «Glück», «Glückseligkeit» oder auch «gedeihliches Leben»: gut zu leben, auch im ethisch-moralischen Sinn. Der beste Weg zur eudaimonia war die ataraxia , die Unerschütterlichkeit, Seelenruhe oder Freiheit von Angst. Ataraxie bedeutet, ein Gleichgewicht zu finden. Es ist die Kunst, Extreme zu vermeiden, sich vor Euphorie in guten, aber auch vor Verzweiflung in schlechten Zeiten zu hüten und seine Leidenschaften zu mäßigen, von denen man sich nicht hin- und herreißen lassen dürfe wie ein Knochen, um den sich eine Meute Hunde streitet.
In der Frage jedoch, wie man diese Seelenruhe erlangt, gingen die Ansichten der einzelnen Schulen auseinander. Wie tief sollte man sich auf die reale Welt einlassen? Die von Epikur im vierten vorchristlichen Jahrhundert gegründete epikureische Gemeinschaft etwa forderte ihre Anhänger auf, ihre Familie zu verlassen und sich wie die Mitglieder eines religiösen Kults in einem «Garten» zu versammeln. Die Skeptiker dagegen nahmen am gesellschaftlichen Leben teil, wenngleich mit einer radikal neuen inneren Einstellung. Die Stoiker standen irgendwo dazwischen. Seneca und Epiktet, die bekanntesten stoischen Autoren, schrieben für eine elitäre römische Leserschaft, die ihre Epoche aktiv mitgestaltete und keine Zeit für Gärten hatte, wenngleich sie Oasen der Stille und Zurückgezogenheit suchte.
Stoiker und Epikureer hatten auch viele philosophische Grundgedanken gemeinsam. Nach ihrer Ansicht werde die Fähigkeit zum Lebensgenuss durch zwei große Defizite gemindert: durch die mangelnde Beherrschung der Affekte und durch die Neigung, dem gegenwärtigen Augenblick zu wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn man diese beiden Probleme in den Griff bekäme, würden sich alle anderen wie von selbst lösen. Allerdings kann man diese Ziele nicht direkt anstreben, sondern muss sich mit Tricks behelfen.
Deshalb entwickelten stoische und epikureische Philosophen vor allem geistige Übungen und Gedankenexperimente. Zum Beispiel: Stell dir vor, heute sei der letzte Tag deines Lebens. Bist du bereit, dem Tod ins Auge zu sehen? Stell dir vor, genau dieser Moment — jetzt! — sei der letzte Augenblick deines Lebens. Was empfindest du bei dieser Vorstellung? Bedauern? Gibt es Dinge, die du gern anders gemacht hättest? Bist du in diesem Augenblick tatsächlich lebendig, oder beherrschen dich Panik, Realitätsflucht oder ein Gefühl der Reue? Dieses Experiment öffnet dir die Augen für das, was dir wirklich wichtig ist, und macht dir bewusst, wie dir die Zeit zwischen den Fingern zerrinnt.
Einige Stoiker inszenierten diesen «letzten Augenblick» mit großem Aufwand. Seneca erzählte von Pacuvius, einem reichen Mann, der keinen Tag vergehen ließ, ohne dass er sich gleichsam selbst das Totenopfer darbrachte. Nachdem er einen Leichenschmaus inszeniert hatte, ließ er sich mit Musikbegleitung in sein Schlafgemach tragen, dabei sangen seine Sklaven und die Gäste: «Er hat gelebt, er hat gelebt.» Dieselbe Wirkung kann man einfacher und billiger haben, wenn man sich nur die eigene Vergänglichkeit vor Augen führt. Der epikureische Schriftsteller Lukrez empfahl, sich selbst im Augenblick des Todes vorzustellen und zwei Möglichkeiten zu erwägen: erstens, dass man gut gelebt hat. In diesem Fall könne man zufrieden aus der Welt gehen wie ein gesättigter Gast, der ein üppiges Festmahl verlässt. Und zweitens, dass man nicht gut gelebt hat. In diesem Fall machte es keinen Unterschied, ob man sein Leben verliert oder nicht, da man ohnehin nicht weiß, was man damit anfangen soll. Für einen Sterbenden ist das nur ein schwacher Trost. Wenn man aber beizeiten anfängt, darüber nachzudenken, ändert sich der Blick auf das eigene Leben.
Читать дальше