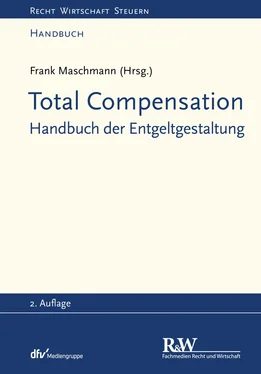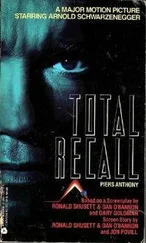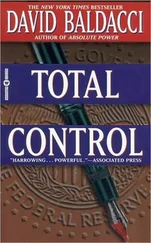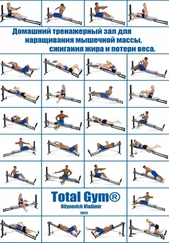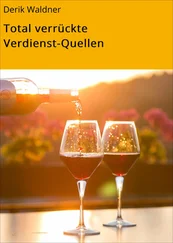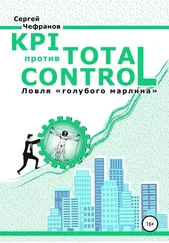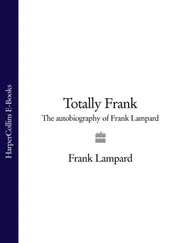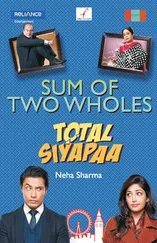27 Kapitel 17 Vergütungssysteme in tarifpluralen Betrieben I. Konfliktlage in tarifpluralen Betrieben II. Die Ermittlung der Gewerkschaftszugehörigkeit als zentrales Problem der Praxis 1. Aspekte des Individualschutzes 2. Aspekte des Koalitionsschutzes 3. Aspekte des gewerkschaftlichen Wettbewerbs 4. Ansätze für eine Gestaltung? 5. Gestaltungen III. Lösung der Tarifpluralität durch § 4a TVG? 1. Zielsetzung und Anwendungsbereich 2. Kollisionsfragen 3. Lösung der Kollision im Betrieb 4. Gestaltungen der Tarifvertragsparteien 5. Abdingbarkeit des § 4a TVG? IV. Lösung von Tarifpluralität durch die Tarifvertragsparteien?1. Gebot der Rücksichtnahme 2. Erwartung des TEG an eine Kooperation der Gewerkschaften 3. Anforderungen an ein kooperatives Modell 4. Gestaltungs-Modelle V. Lösung von Tarifpluralitäten über das BetrVG?1. Tarifvorrang und Tarifsperre aus § 87 Abs. 1 ES und § 77 Abs. 3 BetrVG 2. Öffnungsklauseln im Tarifvertrag VI. Lösung von Tarifpluralität durch die Arbeitsvertragsparteien1. Bezugnahmen unter dem Tarifeinheitsgesetz 2. Die üblichen Formen einer Bezugnahme 3. Regelungslücke durch § 4a TVG? 4. AGB-Kontrolle 5. Gestaltungen VII. Ausblick
28 Kapitel 18 Risikomanagement und Vergütungspolitik – Institutsvergütungsverordnung als Modell I. Interessenlage II. Historische Entwicklung III. Anwendungsbereich der InstitutsVergV IV. Grundsatz der Proportionalität IV. Der Vergütungsbegriff der InstitutsVergV1. Grundsätze 2. Vergütung durch Dritte 3. Garantierte variable Vergütung 4. Abfindungen V. Das Gebot der Nachhaltigkeit der variablen Vergütung 1. Nachhaltigkeitskomponente I: Vergütungsparameter 2. Nachhaltigkeitskomponente II: Begrenzung der Höhe der variablen Vergütung und Poolvorbehalt 3. Nachhaltigkeitskomponente III: Mehrjährige Bemessungsgrundlage und Bonus-/Malussysteme 4. Nachhaltigkeitskomponente IV: Ex-post-Risikoadjustierung
29 Kapitel 19 Entgeltgestaltung und „Low Performance“ I. „Low Performance“ 1. Dogmatische Abgrenzung 2. Maßstab für unzureichende Arbeitsleistung 3. Praktischer Nachweis unzureichender Arbeitsleistung 4. Prozessuales II. Reaktive Gestaltungsmöglichkeiten 1. Individuelle Gestaltungsrechte 2. Einvernehmliche Regelungen 3. Kollektives Arbeitsrecht III. Proaktive Gestaltung von Vergütungssystemen 1. Leistungsentgelte 2. Vergütungsbestandteile mit Änderungsvorbehalten 3. Bonussysteme
30 Kapitel 20 Änderungsvorbehalte zur Flexibilisierung von Sonderzuwendungen I. Fragestellung II. Begriff der Sonderzuwendung III. Rechtsgrundlagen 1. Tarifvertrag 2. Betriebsvereinbarung 3. Arbeitsvertrag 4. Gesamtzusage 5. Betriebliche Übung 6. Schlüssiges Verhalten gegenüber einem Arbeitnehmer 7. Arbeitsrechtlicher Gleichbehandlungsgrundsatz IV. Freiwilligkeitsvorbehalt 1. Zweck der Sonderzuwendung 2. Entgeltcharakter bei Überschreitung des „üblichen Rahmens“ 3. Pauschaler Vorbehalt 4. Konkreter Vorbehalt 5. Freiwilligkeitserklärung bei Auszahlung75 V. Änderungsvorbehalte 1. Widerrufsvorbehalt 2. Kombination von Freiwilligkeits- und Widerrufsvorbehalt 3. Summierung von (Änderungs-)Vorbehalten 4. Anrechnungsvorbehalt 5. Stichtagsregelung – Bindungsklausel – Rückzahlungsklausel VI. Auswirkungen für die Praxis
31 Kapitel 21 Änderungskündigung zur Entgeltsenkung I. Einführung II. Begriff der Änderungskündigung III. Der allgemeine Prüfungsmaßstab der sozialen Rechtfertigung einer Änderungskündigung IV. Änderungskündigung zur Reduzierung der Vergütung im Kontext einer Änderung der Hauptleistungspflicht des Arbeitnehmers 1. Kündigungselement 2. Änderungsangebot V. Änderungskündigung zur isolierten Entgeltreduzierung 1. Reduzierung der im Gegenseitigkeitsverhältnis stehenden Vergütung 2. Änderung sogenannter Nebenabreden 3. Rückgruppierung mittels Änderungskündigung VI. Die Beteiligung des Betriebsrats VII. Zusammenfassung
32 Kapitel 22 Vergütungsordnungen beim Betriebsübergang I. Einführung1. Begriff des Betriebsübergangs (= Betriebsinhaberwechsels) 2. Übergang des Arbeitsverhältnisses nach § 613a BGB 3. Fortwirkung bisheriger Vergütungsordnungen 4. Änderung von Vergütungsordnungen II. Fortwirkung arbeitsvertraglicher Vergütungspflichten1. Eintritt des Erwerbers in die arbeitsvertraglichen Pflichten des Veräußerers 2. Änderung der fortwirkenden Vergütungspflichten 3. Rechtsstellung des bisherigen Arbeitgebers III. Fortwirkung tariflicher Vergütungsordnungen1. Überblick 2. Normative Fortwirkung 3. Überführung von Tarifnormen in das Arbeitsverhältnis 4. Kraft Bezugnahmeklausel geltende Tarifnormen IV. Fortwirkung betrieblicher Vergütungsordnungen1. Überblick 2. Fortwirkung von (Einzel-)Betriebsvereinbarungen 3. Fortwirkung von Gesamtbetriebsvereinbarungen
33 Kapitel 23 Ablösung von Vergütungsordnungen I. Überblick1. Warum eine Ablösung von Vergütungsordnungen? 2. Strategische Vorüberlegungen II. Kollektivrechtliche Ablösungsregelungen 1. Ablösung bestehender tariflicher Systeme durch neuen Tarifvertrag 2. Einseitige Beendigung der unmittelbaren Tarifbindung 3. Ablösung bestehender Systeme durch Betriebsvereinbarungen III. Besonderheiten bei Bezugnahme auf Tarifverträge 1. Wirkungsweise einer Bezugnahmeregelung allgemein 2. Auslegung von Bezugnahmeklauseln vor und nach dem 1.1.2002 3. Statische Inbezugnahme von Tarifregelungen 4. „Kleine“ dynamische Inbezugnahme 5. „Große“ dynamische Inbezugnahme („Tarifwechselklausel“) IV. Individualrechtliche Gestaltungen 1. Änderungsvorbehalte 2. (Massenhafte) Änderungskündigung 3. Änderungsvereinbarungen 4. Wegfall der Geschäftsgrundlage V. Besonderheiten in der Insolvenz
34 Kapitel 24 Bonusregelungen und Zielvereinbarungssysteme I. Begriff der Leistungsvergütung 1. Kriterien der Leistungsvergütung 2. Abgrenzung zu anderen Vergütungsbestandteilen II. Verpflichtungstatbestände und Kontrollmaßstab 1. Arbeitsvertrag und AGB-Kontrolle 2. Betriebsvereinbarung und § 75 BetrVG (Recht und Billigkeit) 3. Gesamtzusage und AGB-Kontrolle 4. Betriebliche Übung und AGB-Kontrolle III. Beschränkungen in Bezug auf den Kreis der Begünstigten IV. Verzielungsprozess und Bonuskriterien1. Unterschied zwischen Zielvereinbarung und Zielvorgabe 2. Zeitpunkt der Verzielung 3. Nachträgliche Anpassung von Zielen 4. Kategorien von Zielen 5. Bonusformel und Wirtschaftsrisiko V. Bemessungszeitraum für Bonuszahlungen VI. Ermittlung des Bonus1. Formelbasierte vs. diskretionäre Bonussysteme 2. Grundsätze der Ermessensausübung 3. Wirtschaftsrisiko und billiges Ermessen 4. Poolsysteme und billiges Ermessen 5. Leistungsbestimmung durch das Gericht VII. Störfälle und Kürzungstatbestände VIII. Darlegungs- und Beweislast IX. Prozessuales
35 Kapitel 25 Provisionen I. Begriff der Provision1. Definition 2. Abgrenzung zu Umsatzbeteiligungen 3. Abgrenzung zu Tantiemen II. Die Verweisung des § 65 HGB – Das gesetzliche Leitbild1. Die Reichweite der Verweisung des § 65 HGB 2. Entstehung des Provisionsanspruches 3. § 87a Abs. 2 HGB – Untergang des Provisionsanspruches 4. § 87c HGB – Fälligkeit der Provision 5. Verhältnis zu Mindestlohn und Tarifverträgen III. Grenzen der arbeitsvertraglichen Gestaltung1. Ausschluss von Folgeprovisionen für Folgegeschäfte, Nachbestellungen von Kunden, die der Arbeitnehmer geworben hat – § 87 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 HGB 2. Ausschluss von Provisionen für Geschäfte, die nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses abgeschlossen oder ausgeführt worden sind IV. Durchsetzung der Provisionsansprüche1. § 87c Abs. 1 HGB – Abrechnung 2. § 87c Abs. 2 HGB – Buchauszug 3. § 87c Abs. 3 HGB – Auskunftsanspruch 4. § 87c Abs. 4 HGB – Einsicht in die Geschäftsbücher V. Provision und Regeln des Lohns ohne Arbeit1. Entgeltfortzahlungsgesetz 2. Urlaubsentgelt 3. Betriebsratsmitglieder – § 37 Abs. 2 BetrVG i.V.m. § 611 BGB VI. Mitbestimmung des Betriebsrates1. § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG 2. § 87 Abs. 1 Nr. 11 BetrVG 3. Rechtsfolgen bei Verletzung des Mitbestimmungsrechts
Читать дальше