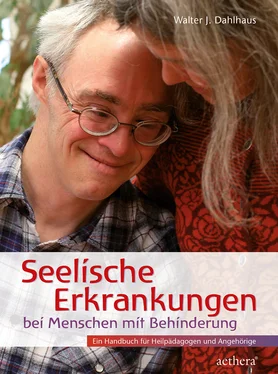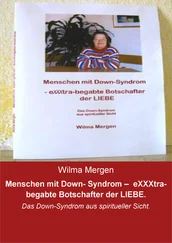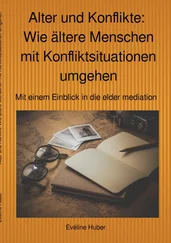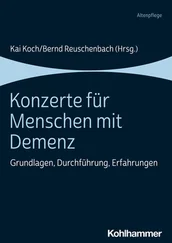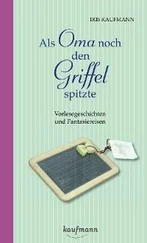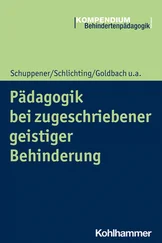Menschenkundliche Aspekte zur Biografie
Die Jahrsiebte
leibliche Reifung
Hinter dem individuellen Schicksal kann neben anderen Rhythmen derjenige von Siebenjahres-Perioden mitprägend gesehen werden. In den ersten drei Abschnitten, bis zum 7., bis zum 14. und bis zum 21. Lebensjahr, erfolgt vornehmlich die leibliche Reifung, mehr oder minder »durch das Schicksal bestimmt«.
Im ersten Abschnitt bzw. »Jahrsiebt« ist die Entwicklung von einem Aufnehmen und Nachahmen des Erlebten geprägt. Leitmotiv für den Erzieher gegenüber dem Kind kann hier die Stimmung sein: »Die Welt ist gut.«
Vom 7. bis zum 14. Lebensjahr besteht bei einem Kind das Bedürfnis, die es umgebende Welt empfindend mitzuerleben, unterstützt durch die Stimmung: »Die Welt ist schön.«
Im dritten Jahrsiebt steht dann ein zunehmend verstehendes Lernen der Bedingungen der Welt im Vordergrund, unterstützt durch die Stimmung: »Die Welt ist wahr.«
Das vierte Jahrsiebt , vom 21. bis zum 28. Lebensjahr, lässt Menschen oft die Fülle der Möglichkeiten der Welt erleben: bis an Grenzen gehen, Freiheit und Verantwortung ausbilden, zunehmend lernen, eigene Urteile zu bilden, dabei aber zu frühe Festlegungen vermeiden, all das ist in dieser Lebensphase wichtig.
28. Lebensjahr
Eine besondere Bedeutung in der Biografie eines Menschen stellt das 28. Lebensjahr dar. Es wirkt oft so, als sei vieles von dem, was einem Menschen »geschenkt« wird, mit diesem Alter in gewisser Hinsicht abgeschlossen; jetzt muss das Leben stärker aus eigener Kraft bewältigt werden.
weitere Jahrsiebte
Im fünften Jahrsiebt , bis zum 35. Lebensjahr, hat sich oft ein konkreter Lebensort gebildet, man ist dann oft »niedergelassen«. Eine mögliche Verstrickung in äußere Verhältnisse kann hier die freie Entfaltung der Biografie beeinträchtigen. Freude an der Fähigkeit zu eigenen Leistungen und die zunehmende Übernahme von Verantwortung prägen diese Zeit.
Im sechsten Jahrsiebt , vom 35. bis zum 42. Lebensjahr, stellt sich zunehmend die Frage, was wirklich wichtig ist – auch die Frage nach dem eigenen Wirksamwerden in der Welt. Sinnfragen tauchen vermehrt auf, vielleicht auch das Bedürfnis, über sich hinauszublicken und Neues zu wagen.
Im siebten dieser Abschnitte , vom 42. bis zum 49. Lebensjahr, kann das Bedürfnis entstehen, die Welt aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu erleben, vielleicht eine Erneuerung aus einer überpersönlichen Perspektive heraus zu suchen. Das Bestreben, Eigenes in die Welt zu stellen, kann vorherrschend werden.
Im Jahrsiebt zwischen dem 49. und dem 56. Lebensjahr kann auch die Entwicklung und Förderung anderer wesentlich für einen Menschen werden; erworbene Kompetenzen möchten jüngeren Menschen zur Verfügung gestellt werden, Selbstlosigkeit kann zunehmende Bedeutung erlangen – vor dem Hintergrund einer wachsenden Fähigkeit, Wesentliches vom Unwesentlichen zu trennen.
Im Lebensabschnitt vom 56. bis zum 63. Lebensjahr entsteht die Möglichkeit, den Blick zunehmend nach innen zu richten; ein bewusster Umgang mit Verzicht, eine wachsende Fähigkeit, »abschiedlich« zu leben, kann sich einstellen.
In dem dann anschließenden Jahrsiebt vom 63. bis zum 70. Lebensjahr kann die Fähigkeit des »Sich-Schenkens« als tief befriedigend erlebt werden.
Hilfe zum Verständnis der Entwicklung
Selbstverständlich sind damit die charakteristischen Merkmale der Jahrsiebte nur kurz angedeutet und in keiner Weise erschöpfend dargestellt. Ich empfinde diese Gesichtspunkte aber als wesentliche Hilfe zum Verständnis einer biografischen Entwicklung.
Aus dem bisher Gesagten mag bereits deutlich werden, in welch eingeschränktem Maße die biografische Entwicklung von Menschen mit Assistenzbedarf zunächst unter diesen Aspekten gesehen werden kann bzw. wie schwierig es für einen Begleiter sein kann, diese Aspekte bei den ihm anvertrauten Personen zu verfolgen. Doch auch wenn die Bedingungen oft eingeschränkt sind, können und sollten wir versuchen, diese übergeordneten Gesetzmäßigkeiten einer Biografie aufzusuchen.
Um noch einmal Romano Guardini zu Wort kommen zu lassen: »Jede Phase hat ihren eigenen Charakter, der sich so stark betonen kann, dass es für den sie Lebenden schwer wird, aus ihr in die nächste überzugehen.« 6
Was verbirgt sich hinter den sogenannten Mondknoten?
Zusammentreffen von Vergangenheit und Zukunft
Alle 18 Jahre, 7 Monate und 9 Tage steht der Schnittpunkt der Bahnen von Sonne und Mond im Verhältnis zum Fixsternhimmel an derselben Stelle wie bei der Geburt eines Menschen. Wenn wir den Mond als Ausdruck für Vergangenes und die Sonne als Bild für das Zukünftige sehen, beschreibt diese Konstellation das Zusammentreffen von Vergangenheit und Zukunft im Jetzt.
Oder wie Rudolf Steiner es formulierte:
Das Künftige ruhe auf Vergangenem .
Vergangenes erfühle Künftiges
Zu kräftigem Gegenwartsein. 7
Der Mondknoten-Rhythmus ist ein kosmischer Rhythmus, der sich in der individuellen Biografie widerspiegeln kann, also oft Auswirkungen auf die entsprechenden Phasen im Leben eines Menschen hat.
Zeiten des Aufbruchs und Umbruchs
Wir erleben den ersten dieser Mondknoten mit gut 18 ½ Jahren, den zweiten mit etwa 37 Jahren und 3 Monaten, den dritten mit etwa 55 Jahren und 10 Monaten, den vierten mit gut 74 Jahren. Es können dies Zeiten des Aufbruchs, vielleicht auch des Abschieds, oft des Umbruchs sein. Der Begriff des »Sterbens« liegt hier nahe – Sterben als dieses tiefste Loslassen, als umfassendsten Ausdruck für Abschied wie Aufbruch.
»Rubikon«
Für die pädagogische Arbeit wichtig ist auch die Kenntnis des halben Mondknotens. Gemeint ist die Zeit, die ein Mensch mit ungefähr 9 Jahren und 3 Monaten durchlebt. In seiner »Menschenkunde« nennt Rudolf Steiner diese Zeit den »Rubikon«, 8in Anlehnung an die Überschreitung des Flusses Rubikon durch Caesar. Damit wird eine Situation bezeichnet, in der es kein Zurück gibt, in der etwas radikal anders wird – ein Umbruch hin zu etwas gänzlich Neuem.
Unter dem menschenkundlichen Aspekt betrachtet, beschreibt dies eine konstitutionelle Veränderung. Das Seelische des Kindes schwingt immer weniger mit der Umgebung mit, sondern bildet mehr und mehr einen selbstständigen Innenraum. Menschenkundlich ausgedrückt heißt das: Der »zentrale Punkt« (das »Ich«) des Kindes verlagert sich in die Stoffwechsel-Gliedmaßen-Region, also in den zentralen Ort des Willenslebens – den Ort der individuellen Schicksalsgestaltung.
Bedeutung des Rubikons
Rudolf Steiner misst dieser Umwandlung eine große Bedeutung zu. Immer wieder hat er betont, wie wichtig die liebevolle Begleitung eines Kindes in diesem Lebensalter ist.
Viele Kinder erleben diesen »Rubikon«-Lebensabschnitt sehr konkret. Die innere Nähe von »Umbruch« und Aspekten des »Sterbens«, wie sie oben bereits beschrieben wurden, kann sich unter anderem auch in konkreten Ängsten vor dem Sterben, zum Teil im übergeordneten Sinne, zeigen:
•Ein Kind kommt morgens ins Zimmer, steht lange vor der Uhr, weint heftig und sagt: »Es ist alles so anders geworden.«
•Ein anderes Kind sucht nach den Eltern, die gerade im benachbarten Bauernhof Milch holen, wie sie es auch sonst immer tun (also eine eigentlich vertraute Situation), und beginnt aus tiefer Angst zu schreien. Später sagt es: »Ich dachte, ihr seid gestorben.«
•Ein Kind betrachtet sinnend die Haare seiner Schwester und sagt: »So wie diese Haare heute liegen, werden sie das nie wieder tun.«
Читать дальше