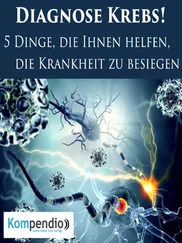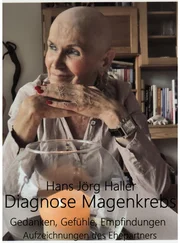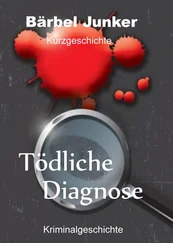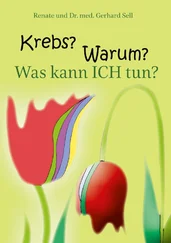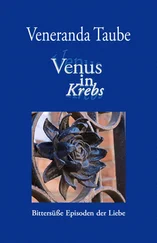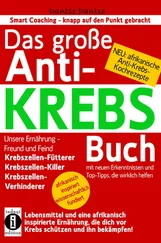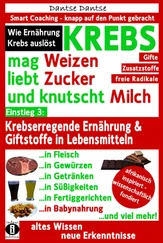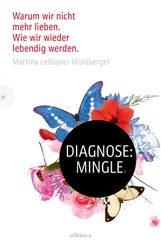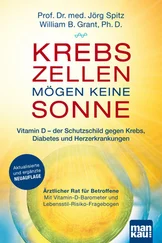Doch wann ist der richtige Zeitpunkt, die Familie über die Erkrankung zu informieren? Eine allgemeingültige Antwort darauf gibt es nicht, es gibt auch keinen „richtigen“ oder „falschen“ Moment. Wenn Sie bereits von dem Verdacht auf Krebs wussten und in die nachfolgenden Untersuchungen Ihres Angehörigen eingebunden waren, können Sie gemeinsam überlegen, welche Familienmitglieder Sie einweihen möchten und wann. Nicht alle müssen zum jetzigen Zeitpunkt bereits informiert werden, manche, zu denen Ihr Angehöriger keine enge Beziehung hat, vielleicht auch später nicht.
Wichtig ist, dass sich Ihr Angehöriger mit der Auswahl derer, die aus dem Kreis der Eltern, Geschwister oder anderen Verwandten informiert werden, gut fühlt. Er sollte allerdings auch eins bedenken: Er wird sich durch die Krankheit verändern, innerlich und äußerlich. Familienmitglieder, die den Grund dafür nicht kennen, werden Vermutungen darüber anstellen, möglicherweise falsche Schlüsse ziehen, sich innerlich von ihm entfernen und sich zurückziehen.
Vielleicht ist unter diesen nicht informierten Verwandten aber jemand, der Ihnen Halt geben oder Sie später in praktischorganisatorischen Belangen im Alltag unterstützen könnte. Dann besprechen Sie mit Ihrem Angehörigen, ob er einverstanden ist, dass diese Person doch von seiner Krankheit erfährt. Sicher werden Sie zusammen zu einer Entscheidung finden, die beide mittragen können. Hüten Sie sich aber davor, einen Wunsch Ihres Angehörigen nicht zu respektieren und jemanden hinter seinem Rücken zu informieren.
Eltern haben das Bedürfnis, ihre Kinder vor dem Bösen der Welt zu schützen. Leider ist das nicht immer machbar. Die Diagnose Krebs trifft die ganze Familie, und deshalb sollten das Kind oder die Kinder bald von der Erkrankung erfahren. Mehr noch als Erwachsene haben sie ein feines Gespür dafür, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Es wird ihnen nicht entgehen, wenn die Eltern gereizt, traurig oder niedergeschlagen sind, wenn vielleicht Gespräche unterbrochen werden, sobald das Kind dazukommt. Dann ist die Gefahr groß, dass die Kinder die Ursache für dieses ungewohnte Verhalten bei sich selbst suchen, sich die Schuld geben und sich fragen, ob sie etwas falsch gemacht haben. Kinder haben eine blühende Fantasie, und was sie sich an Schreckensszenarien ausmalen, übertrifft meistens die Realität und belastet sie mehr als die Wahrheit.
Mit Beginn der Behandlung Ihres Angehörigen wird sich auch ein Teil der Alltags-routine ändern, und wenn Kinder nicht wissen, warum dies geschieht, macht es ihnen Angst. Beziehen Sie daher Ihre Kinder beizeiten ein und lassen Sie sie ein Teil Ihres familiären Netzwerks sein. Von dem offenen Umgang mit der Krankheit wird die ganze Familie profitieren.
Checkliste
Tipps für das erste Gespräch
Wenn der Betroffene und Sie entscheiden, andere Angehörige ins Vertrauen zu ziehen, könnten Ihnen diese Tipps helfen:
Führen Sie das Gespräch erst, wenn Sie sich bereit dazu fühlen.
Wählen Sie für das Gespräch einen Zeitpunkt aus, an dem genügend Zeit dafür ist.
Sorgen Sie für eine ruhige Atmosphäre ohne Störungen und Ablenkungen.
Fallen Sie nicht mit der Tür ins Haus, sondern wählen Sie einen behutsamen Einstieg.
 Geben Sie eine Information nach der anderen, sodass Ihr Gesprächspartner sie nach und nach verarbeiten kann.
Geben Sie eine Information nach der anderen, sodass Ihr Gesprächspartner sie nach und nach verarbeiten kann.
Wenn Ihnen ein persönliches Gespräch zu viel ist, telefonieren Sie stattdessen, schreiben Sie einen Brief oder eine E-Mail.
Ihr Angehöriger steht im Fokus! Er sollte nicht darüber grübeln, wie sich die Nachricht für seine Gegenüber am schonendsten „verpacken“ lässt und was er tun kann, um die Gesprächspartner emotional aufzufangen. Wichtig ist, dass er sich dabei sicher fühlt.
Sicher werden Sie das Gespräch mit den Kindern gemeinsam führen; es kann aber sinnvoll sein zu überlegen, ob Ihr Angehöriger selbst über seine Krankheit spricht oder ob lieber Sie es machen sollen. Das hängt zum Beispiel davon ab, wie gefasst Sie oder Ihr Angehöriger auftreten können. Was genau Sie Ihren Kindern sagen und wie, ist auch eine Frage des Alters der Kinder, denn je nach Alter nehmen sie Informationen unterschiedlich auf. Es gibt aber einige grundsätzliche Empfehlungen:
 Informieren Sie Ihr Kind in Etappen, die Aufmerksamkeit von jüngeren Kindern ist begrenzt, und es muss Zeit haben, die Informationen zu verarbeiten.
Informieren Sie Ihr Kind in Etappen, die Aufmerksamkeit von jüngeren Kindern ist begrenzt, und es muss Zeit haben, die Informationen zu verarbeiten.
Versuchen Sie, Ihrem Kind Ruhe und Sicherheit zu vermitteln.
 Erklären Sie Ihrem Kind, dass es nicht schuld an der Krebserkrankung ist.
Erklären Sie Ihrem Kind, dass es nicht schuld an der Krebserkrankung ist.
Nennen Sie die Krankheit beim Namen und sagen Sie deutlich, dass Krebs nicht ansteckend ist.
Erklären Sie in einfachen Worten und kurzen, klaren Sätzen. Sie können versuchen, das Gespräch mit Ihrem Angehörigen oder einer vertrauten Person vorher durchzuspielen.
Erklären Sie, was passieren wird, wenn Papa oder Mama zum Beispiel ins Krankenhaus muss. Was sich später ereignen oder ändern wird, ist für Ihr Kind im Augenblick noch nicht interessant.
Was immer Sie Ihrem Kind sagen: Es muss wahr sein. Machen Sie keine unrealistischen Versprechungen.
Schildern Sie, was sich im Alltag Ihres Kindes verändern wird. Wer wird es zum Beispiel aus dem Kindergarten holen, wenn die Mutter im Krankenhaus ist? Wer kommt mit zum Fußball? Wer kümmert sich um die Hausaufgaben?
 Unterdrücken Sie Ihre Gefühle nicht, denn Ihr Kind soll erleben und sicher sein, dass es auch Gefühle zeigen darf. Es ist aber gut, wenn Sie bei dem Gespräch nicht völlig aufgelöst sind.
Unterdrücken Sie Ihre Gefühle nicht, denn Ihr Kind soll erleben und sicher sein, dass es auch Gefühle zeigen darf. Es ist aber gut, wenn Sie bei dem Gespräch nicht völlig aufgelöst sind.
Wenn das erste Gespräch beendet ist, signalisieren Sie Ihrem Kind, dass es Sie immer alles fragen kann.
 Jüngeren, aber durchaus auch älteren Kindern gibt körperliche Nähe Vertrauen und Sicherheit. Kuscheln und schmusen Sie mit Ihren Kindern, wenn alle das Bedürfnis danach haben.
Jüngeren, aber durchaus auch älteren Kindern gibt körperliche Nähe Vertrauen und Sicherheit. Kuscheln und schmusen Sie mit Ihren Kindern, wenn alle das Bedürfnis danach haben.
Bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu zwei Jahren müssen Sie bedenken, dass sich das Sprachverständnis erst entwickelt. Trotzdem werden diese Kinder zum Beispiel merken, wenn eine Bezugsperson nicht da ist oder wenn sie sich körperlich verändert, z. B. die Haare verliert. Es empfiehlt sich, zu erklären, was sich ändert und was bestehen bleibt (z. B. „Oma holt dich aus der Kita ab, aber Mama liest weiterhin die Gute-Nacht-Geschichte.“). Für sie ist es auch sehr wichtig, dass sie sich sicher fühlen. Dabei hilft besonders körperliche Nähe; so merken sie, dass eine vertraute Person für sie da ist. Nehmen Sie Ihr Kind öfter in den Arm oder schmusen Sie mit ihm beim Einschlafen.
Mit den Größeren offen sprechen
Mit Kindern im Kindergartenalter (bis zu etwa sechs Jahren) können Sie kurze Gespräche führen und dabei auch das Wort „Krebs“ verwenden. Diese Kinder haben schon Erfahrungen mit Krankheit gemacht, eigene oder auch in ihrem kindlichen Umfeld. Allerdings sind dies in der Regel ansteckende (Kinder-)Krankheiten; mit Krebs können sie nichts verbinden. Vermitteln Sie ihnen besonders, dass sie an der Erkrankung keine Schuld haben. Sie können sich bei Papa, Mama oder Opa nicht anstecken und weiterhin mit ihnen kuscheln.
Читать дальше
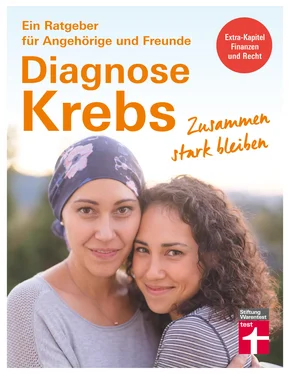
 Geben Sie eine Information nach der anderen, sodass Ihr Gesprächspartner sie nach und nach verarbeiten kann.
Geben Sie eine Information nach der anderen, sodass Ihr Gesprächspartner sie nach und nach verarbeiten kann. Informieren Sie Ihr Kind in Etappen, die Aufmerksamkeit von jüngeren Kindern ist begrenzt, und es muss Zeit haben, die Informationen zu verarbeiten.
Informieren Sie Ihr Kind in Etappen, die Aufmerksamkeit von jüngeren Kindern ist begrenzt, und es muss Zeit haben, die Informationen zu verarbeiten.