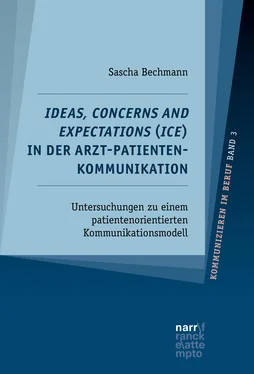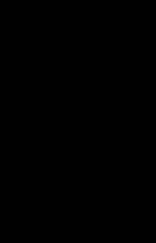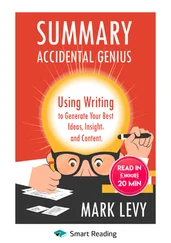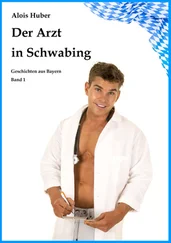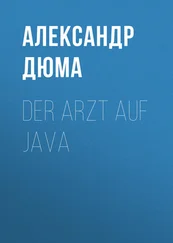Das Modell des shared decision making (SDM) oder collaborative decision making 5 (CDM) wird in Deutschland mit der Bezeichnung partizipative Entscheidungsfindung 6 (PEF) übersetzt und sagt aus, dass ein tragfähiges Beziehungsmodell zwischen Ärzten und Patienten auf einem „wechselseitigen Prozess der Berücksichtigung medizinischer und zugleich psychologischer Erfordernisse basiert“7. Dieser Prozess ist untrennbar verwoben mit der Einsicht, dass einzig durch den wechselseitigen Austausch relevanter Informationen a) Verständnis hergestellt und b) Einverständnis erzielt werden kann:
Damit der Patient unmittelbar an der Verantwortung beteiligt ist (und nicht nur an der Entscheidung wie im Konsumentenmodell), bedarf es hier der Bereitschaft des Patienten, wichtige Informationen zu teilen, Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen mitzutragen.8
Das Teilen von Informationen, das Tragen von Konsequenzen und die Möglichkeit, Entscheidungen treffen zu können, korreliert m.E. mit den kognitiven Dimensionen Ideen ( ideas ), Befürchtungen ( concerns ) und Erwartungen ( expectations ), die als Grundlage für die Entwicklung des ICE-Modells zu werten sind.9
So ist die Informationsebenestets verbunden mit Vorstellungen und Ideen ( ideas) über z.B. Krankheitsschwere, Krankheitsdauer oder Krankheitsursachen.1 Solche Laienvorstellungen, insbesondere über die Ätiologie von Krankheiten(verstanden als Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge), sind traditionell Gegenstand der medizinischen Psychologie sowie der Ethnomedizin.2 Der Ansatz dieser Forschungsrichtung ist stark geprägt von der Einsicht, dass das Wissen des Arztes über Laienvorstellungen entscheidend dazu beitragen kann, das Beziehungsgefüge zwischen Arzt und Patient positiv zu beeinflussen. Die Vorstellungen und Ideen der Patienten zu kennen ist notwendig, „um sie für eine positive Veränderung von Krankheitsverläufen im Sinne einer verbesserten ,compliance‘ durch den Patienten selbst fruchtbar zu machen“3. Somit stellen die Laienvorstellungen das Fundament dar, auf dem erfolgreiche Aufklärung und die weiteren Schritte auf dem Weg hin zu einer partizipativen Entscheidungsfindung überhaupt erst einen sicheren Stand finden. Verbunden damit ist die Tatsache, dass es sich bei den meisten Krankheiten
1 um sehr komplexe und abstrakte – und für Laien oft schwer zu fassende – medizinisch-pathologische Zusammenhänge handelt und
2 Ideen von der Pathogenese sowie von den Möglichkeiten der Heilung oft eingebunden sind in ein festes Werte- und Normengefüge, in welchem der Arzt aufgrund seiner Profession eine zentrale Rolle spielt.
Insbesondere Erwartungen ( expectations ) sind eng verwoben mit dieser Vorstellung von der Rolle des Arztes als Heiler (s.u.). Als Problem für die Arzt-Patient-Beziehung erweist sich mit Blick auf das (disparate) Wissen der Patienten über Krankheiten die Diskrepanz zwischen den Wissensbeständen der Patienten als Laien und dem Wissen der Ärzte als Experten. Hier gilt es, durch gezieltes Erfragen der ideas , eine Vorstellung davon zu bekommen, was Patienten wissen (bzw. glauben) und was nicht. In Zeiten von „Dr. Google“ ist dieses Wissen sehr unterschiedlich ausgeprägt und oft bruchstückhaft.
Die Erfragung von Vorstellungen und Ideen ist funktional bedeutsam: Die patientenseitigen Vorstellungen werden sehr häufig von ihnen selbst für Erklärungsversuche eingesetzt, was zu erheblich greifbareren und nachvollziehbareren Zusammenhängen beiträgt.
Dieser Aspekt könnte für die Arzt-Patient-Interaktion insgesamt förderlich sein:
Diese Art des Erklärens, die auf bruchstückhaftem Wissen und heterogenen Vorstellungen sowie auf Ableitungsregeln mit hinreichendem Allgemeingültigkeitsanspruch basiert, könnte man als ,Laientheoretisieren’ ansehen. Der Umgang der [Patienten] mit ihren eigenen Wissensbeständen innerhalb eines Institutionenkontextes hat einen prozeßhaften Charakter. Gerade der Einblick in diese Prozeßhaftigkeit […] könnte für die Beratungspraxis (insbesondere für die Informationsvermittlung und -bewertung) fruchtbar gemacht werden.4
Neben die medizinisch-psychologische Betrachtung treten gegenwärtig die kognitionswissenschaftlichen Disziplinen, die in neuerer Zeit Krankheitsmodelle auf der Basis von kollektiven und individuellen Wissensbeständen entwerfen. So ist etwa aus der Kognitionslinguistikbekannt, dass bereits Krankheitslabels (Krankheitsnamen) Vorstellungen über solche Parameter (verstanden als konkrete Vorstellungen oder Ideen) evozieren. Die sogenannte Frame-Theoriegeht davon aus, dass in Begriffen Sprach- und Weltwissen gemeinsam angelegt sind und dass solche Begriffe abstrakte Vorstellungswelten auslösen.5 Die Idee von einer Krankheit wird auf diese Weise durch Welt- und Erfahrungswissen maßgeblich beeinflusst. Im Modell des CDM (dt. PEF) sind die Informationen über die eigenen Vorstellungen und das Wissen über die eigene Erkrankung tragende Säulen des wechselseitigen Aushandlungsprozesses, da dieser wesentlich auf dem Teilen und der Bereitstellung gemeinsam nutzbaren Wissens basiert. Es handelt sich nämlich um einen „Interaktionsprozess mit dem Ziel […], unter gleichberechtigter und aktiver Beteiligung von Patient und Arzt auf Basis geteilter Informationenzu einer gemeinsam verantworteten Übereinkunft zu gelangen“6. Ideas werden im ICE-Modell verstanden als „every opinion of the patient about a possible diagnosis, treatment, or prognosis“7.
Auf der Ebene der Konsequenzensind u.a. Befürchtungen ( concerns) verortet. Hier wird die emotive Dimensionder Arzt-Patient-Kommunikation erkennbar, die ebenfalls von Bedeutung für den w. o. genannten Aushandlungsprozess ist (an dessen Ende im Idealfall gegenseitiges Verständnis und Vertrauen steht). Levenstein et al. erkennen bereits 1986 insbesondere diese emotive Dimension des Patienten-Frameworks als zentral für den Prozess der Patientenzentrierung über den Weg der Zusammenführung von Arztperspektive und Patientenperspektive:
When a patient consults a physician, he has a certain agenda in mind. We have chosen to define this in terms of his expectations, feelings and fears. The doctor also has his agenda, which in general may be stated as the correct diagnosis of the patient’s complaints and the implementation of preventive procedures that are appropriate for the patient’s age, sex and risk factors. For individual patients he may have a more specific agenda based on previous knowledge of the patient and his family. In the patient-centred method, the physician’s aim is to ascertain the patient’s agenda and to reconcile this with his own.1
Matthys et al. beschreiben diese emotive Dimension sehr treffend als „the expressed fear/worry of the patient about a possible diagnosis or treatment“2.
Die gesprächsinteraktionale Berücksichtigung von Ängsten und Befürchtungen stellt eine Abkehr von der traditionellen schulmedizinischen Konzeption dar, in der allein die somatischen Komponenten von Bedeutung sind.3 Dabei bilden somatische Phänomene und psychische Prozesse eine untrennbare Einheit, die auch im Gespräch nicht aufgelöst werden darf: „Gegenstand des Arzt-Patienten-Gesprächs sind […] mehr oder weniger gravierende Beschwerden, Krankheiten und somatische Ausnahmezustände, und diese sind unweigerlich mit einem bestimmten, mehr oder weniger starken Erleben und entsprechenden Emotionen verbunden“4. Diese Festlegung gilt nicht nur für Erkrankungen, sondern auch für lebensverändernde Situationen, in denen Ärzte die Rolle des Aufklärers übernehmen. So kann auch die Mitteilung einer Schwangerschaft ohne medizinische Risiken bereits zahlreiche Ängste auslösen. An diesem Beispiel lässt sich die Komplexität psychischer Prozesse infolge eines somatischen Befunds gut zeigen, denn eine Schwangerschaft ist
Читать дальше