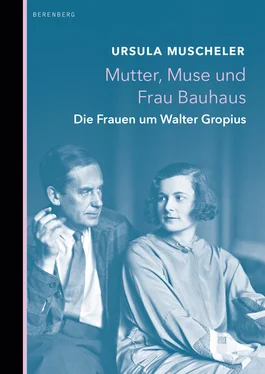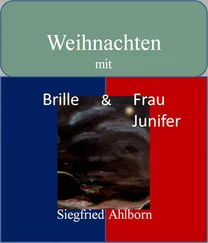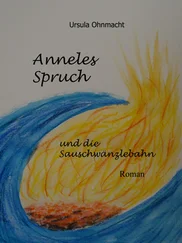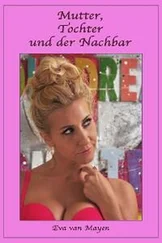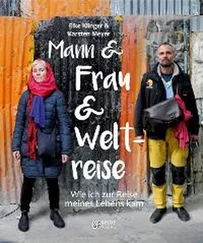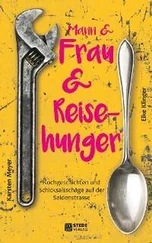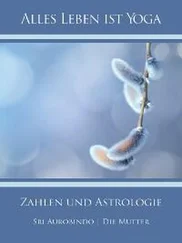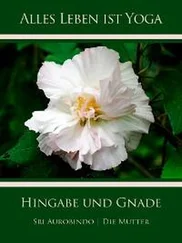Zemlinsky sollte Recht behalten. Es gelangen Alma zwar einige bemerkenswerte Liedkompositionen nach Gedichten von Novalis, Rilke und Dehmel von, wie es in Fachkreisen heißt, emotionaler Intensität, doch es fehlte ihr an unbedingter Hingabe, ohne die in der Kunst nichts zu erreichen ist. Das mag sie selbst gefühlt und daher gehofft haben, dass der um sie werbende Mahler als Ehemann ein väterlicher Mentor werden und ihre kompositorischen Ambitionen unterstützen würde. Als Mahler aber vor der Eheschließung von ihr forderte, zukünftig auf eigene Arbeiten zu verzichten, da ein komponierendes Ehepaar eine zu lächerliche Angelegenheit sei, gab sie ohne Widerspruch nach – nicht ohne Mahler später vorzuwerfen, ihr Talent schändlich unterdrückt zu haben.
Dabei hätten sich Alma zur Ehe mit Mahler durchaus Alternativen geboten. Sie zählte zu den Schönheiten Wiens und hatte die Wahl zwischen vielen Verehrern. Zudem war das künstlerische Milieu, in dem sie sich bewegte, für unkonventionelle Lebensentwürfe, auch von Frauen, durchaus offen. Doch Alma schien nicht so recht an die eigenen Fähigkeiten, an weibliche Kreativität überhaupt, zu glauben und zog es vor, einen bereits arrivierten Mann zu heiraten, der ihr als Direktor der Wiener Hofoper ein gutes Einkommen und einen hohen gesellschaftlichen Status verschaffte. Sie trat mit dieser Entscheidung in die Fußstapfen ihrer Mutter, die zwar eine Gesangsausbildung am Wiener Konservatorium absolviert, nach der Heirat den Beruf aber aufgegeben hatte.
Das Verhältnis zwischen Alma und Gropius blieb der Mutter in Berlin nicht verborgen. Sie sei, so schrieb sie dem Sohn, über seine Wahl zwar nicht glücklich, respektiere sie aber. Was sie allerdings verletze, sei, dass er sie nicht eingeweiht habe. »Hier geht stark das Gerücht, Du würdest Dich gleich nach dem Krieg verheiraten. Warum verschweigst Du mir das, mein Walter, wenn es wahr ist? Zweifelst Du an meinem Verständnis, oder fürchtest Du, mich zu sehr zu erregen? Sei versichert, dass beides nicht nötig ist, und dass ich ganz glücklich und zufrieden bin, wenn Du es bist … Glaube mir, dass ich mir alle Mühe geben werde, mit Deinen Augen zu sehen, die ja doch helle genug sind und sich auch hoffentlich hierin nicht täuschen.« 25
Doch Manon Gropius konnte sich mit Alma nicht abfinden. Die freizügige, leidenschaftliche Wienerin war und blieb der nüchternen, disziplinierten Preußin fremd. Es falle ihr unendlich schwer, schrieb sie dem Sohn, die Geliebte mit seinen Augen zu sehen. Vielleicht müsse sie Alma erst einmal besser kennenlernen, momentan jedenfalls könne sie sich mit seiner Wahl nicht einverstanden erklären. Nach einem Besuch der beiden gestand sie: Die mit ihm und Frau Mahler durchlebten und durchkämpften Tage seien wie ein Sturmwind über sie hinweggebraust und hätten sie gebeugt und völlig erschöpft zurückgelassen.
Die Antwort des Sohnes war schonungslos und wirkt, als hätte sich so einiges an Ärger über die mit Liebe und Fürsorge verbundene Strenge und Dominanz der Mutter über die Jahre angesammelt. Der geistige Abstand, der sie, so schrieb er, trenne, sei vielleicht doch zu groß, um überwunden werden zu können. Im Gegensatz zu ihr, die stehen geblieben und versteinert sei, sei er rapide vorwärtsgeschritten, habe ein neues Selbstvertrauen gewonnen und werde seinen eigenen Vorstellungen gegen jeden Widerstand nachleben. Wenn sie an seinem Glück zukünftig teilnehmen wolle, müsse sie über ihren Schatten springen und Alma einen versöhnlichen Brief schreiben.
Die Mutter tat, wie ihr geheißen. Sie wollte wohl die gestörte Mutter-Sohn-Beziehung wieder festigen und den Sohn, der an der Moselfront kämpfte, nicht durch familiäre Differenzen zusätzlich belasten. Sie wusste wie nur wenige von seinen gefährlichen Einsätzen und den vielen Toten, die ihn umgaben und die es wie ein Wunder erscheinen ließen, dass er selbst noch unverletzt geblieben war. Erstaunt hatte Gropius der Mutter einmal geschrieben: »Wir können nicht dankbar genug sein für das Glück, das über mir waltete. Die Kugeln haben mich in diesem Kriege nun schon vollständig umschrieben: eine in die Pelzmütze, eine in die Stiefelsohle, eine rechts, eine links durch den Mantel – und die schauerliche Granate.« 26
Alma Mahler und Walter Gropius heirateten am 18. August 1915 in Berlin, standesamtlich und ohne Familie, Trauzeugen waren zwei Passanten von der Straße. Nach der Trauung kehrte Gropius, der nur zwei Tage Sonderurlaub erhalten hatte, an die Front zurück, Alma nach Wien. Alma schien nun, wenn auch die Heirat auf ihren Wunsch vorerst geheim gehalten wurde, am Ziel ihrer Wünsche und nahm sich im Tagebuch fest vor: Nichts sollte sie in Zukunft mehr aus der Bahn schleudern. Nichts wollte sie mehr, als diesen Menschen glücklich machen.
Doch Beständigkeit war Alma nun einmal nicht gegeben. Bald schlug der Ton ihrer Briefe um. Eine Flut von Klagen und Beschwerden erreichte die Front. Obwohl Gropius nicht immer die Möglichkeit hatte, Briefe zu empfangen und sofort zu beantworten, warf Alma, die sich in ihrem Haus auf dem Semmering und der Zehn-Zimmer-Wohnung im ersten Wiener Gemeindebezirk die harte Realität des Schützengrabens wohl nicht so recht vorstellen konnte, ihm vor, dass er so selten schreibe und sie nicht so sehr liebe wie sie ihn. Sie urteilte verächtlich über Walters Familie, über Berlin und die Berliner, beklagte missmutig seine Abwesenheit, seinen Mangel an Aufmerksamkeit, bezweifelte seine eheliche Treue und drohte, wenn es ihm einfallen sollte, sie zu betrügen, sich auf die gleiche Weise zu rächen.
Einziger Lichtblick für Gropius war in dieser schwierigen Zeit wohl die Anfrage vom April 1915 aus Weimar, ob er sich vorstellen könne, die Nachfolge Henry van de Veldes als Direktor der Großherzoglich Sächsischen Kunstgewerbeschule anzutreten. Der Belgier van de Velde, der seit Kriegsbeginn als feindlicher Ausländer galt, hatte sein Amt niederlegen und dem Ministerium einen geeigneten Nachfolger vorschlagen müssen. Er hatte neben anderen Walter Gropius genannt. Gropius berichtete der Mutter, dem Angebot nach anfänglichen Zweifeln nun doch nähertreten zu wollen, da ihm ein solcher Posten Ansehen und die Möglichkeit zu großen Aufträgen verschaffen würde.
Er bat die Mutter, Pläne, Fotos und Veröffentlichungen seiner Bauten und Projekte zusammenzustellen und für alle Fälle bereitzuhalten. Sie widmete sich dieser Aufgabe mit der Hilfe Adolf Meyers gewissenhaft und wohl in der Hoffnung, den Sohn bald auf einem nicht nur sicheren, sondern für einen Architekten ohne akademischen Abschluss ehrenvollen Posten zu wissen, und bestärkte ihn in seinem Entschluss: »Ich finde es ganz richtig, dass Du van de Velde in bejahendem Sinne geschrieben hast, Du hast ja immer schon Lehr-Ideen gehabt, und es wäre doch für Dich eine große Ehre. Auch wäre es ja angenehm, gleich nach dem Kriege so eine feste Sache zu haben, die Dir Halt geben würde.« 27
Die eigentliche Schützenhilfe bei den folgenden Berufungsverhandlungen aber leistete Alma. Sie riet Gropius, den Posten nur anzunehmen, wenn man ihm schriftlich alle Kompetenzen, die er verlange, zugesichert habe und die Fragen nach Geld und Titel zufriedenstellend geklärt seien. Er müsse das Bestmögliche herausholen, denn sie könne ihn sich nicht, so angenehm ihr Weimar als Ort der Kultur auch erscheine, in untergeordneter künstlerischer Stellung vorstellen. Ende 1915 begleitete sie Gropius, der ein paar Tage Fronturlaub bekommen hatte, höchstpersönlich zur Verhandlung nach Weimar.
Ansonsten wechselten nach wie vor Klagen zwischen der Front, Berlin und Wien hin und her. Es ist überhaupt erstaunlich, wie viele Briefe und Postkarten während des Krieges geschrieben und befördert wurden. 28 Milliarden waren es insgesamt über die Kriegsjahre. Regierung und Armeeführung wussten wohl, dass sich der Kampfeswille an der Front nur durch einen funktionierenden Postverkehr mit der Heimat aufrechterhalten ließ.
Читать дальше