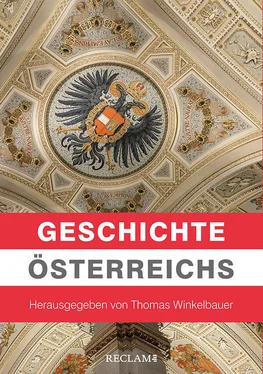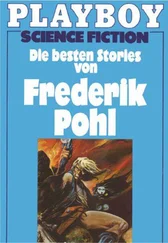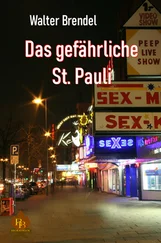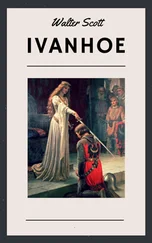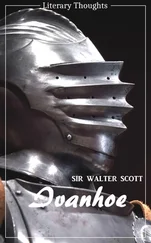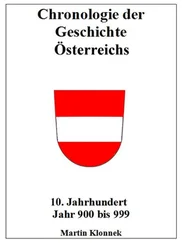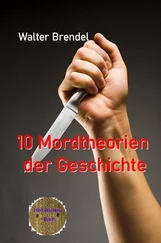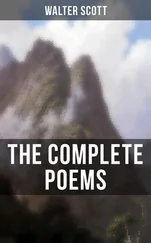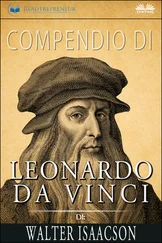Jede »Geschichte Österreichs« ist letzten Endes ein Konstrukt, ein Konstrukt freilich, das die Österreichhistoriker nicht nur den historisch wissbegierigen Österreicherinnen und Österreichern, sondern allen an der Geschichte Europas und Österreichs in Europa Interessierten schuldig sind.
Von der römischen Herrschaft bis zur Karolingerzeit (15 v. Chr. bis 907)1
Von Walter Pohl
Die fast 1000 Jahre von der römischen Besetzung des Ostalpen- und Donauraumes bis zur Ungarnzeit bieten kaum eine einheitliche Erzählperspektive. Zu keiner Zeit unterstand der gesamte Raum des heutigen Österreich einer länger andauernden einheitlichen Herrschaft. In der Römerzeit, von 15 v. Chr. bis 487 n. Chr., ging Roms direkter Machtbereich bis zur Donau, und auch wenn der Raum nördlich davon oft weitgehend kontrolliert wurde, gelang die mehrfach geplante Errichtung einer Provinz nicht. Auch das Karolingerreich beherrschte vom Awarensieg Karls des Großen (796) bis zur bayerischen Niederlage gegen die Ungarn bei Pressburg (907) im wesentlichen den Raum südlich der Donau, während nördlich davon die Mährer trotz mehrfacher Unterwerfung nicht integriert werden konnten. Nie befand sich in der in diesem Abschnitt behandelten Epoche auf dem Gebiet des heutigen Österreich ein überregional bedeutsames Herrschaftszentrum, es wurde meist von außerhalb dominiert. Rom beherrschte weite Teile des Raumes von Italien aus, Hunnen im 5. und Awaren im 6.–8. Jahrhundert aus dem heutigen Ungarn, das bayerische Herzogtum der gleichen Epoche von Regensburg aus, und die Residenzen des karolingischen Frankenreiches lagen zunächst noch weiter westlich, etwa in Aachen.
Eine »Geschichte Österreichs« in dieser Zeit kann daher, nach dem Vorbild der ersten Bände der von Herwig Wolfram herausgegebenen Österreichischen Geschichte , nur von »Grenzen und Räumen« handeln, die in unterschiedlichem Maß von Mächten außerhalb des hier behandelten Gebietes dominiert und beeinflusst wurden. Dabei blieb der Raum Begegnungszone sehr unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen: von Kelten, Römern und Germanen in der Römerzeit; von germanischen Völkern, römischen Provinzialen und Steppenreichen in der Völkerwanderungszeit des 5./6. Jahrhunderts; von Bayern, Romanen, Slawen und Awaren ab der Mitte des 6. Jahrhunderts; gegen 800 kamen dazu noch Franken und andere Bewohner ihres Reiches, während die Awaren verschwanden und ein knappes Jahrhundert später von den Ungarn ersetzt wurden. An der Besiedlung des Raumes hatten diese Völker und Sprachgruppen in sehr unterschiedlichem Maß Anteil. Um 900 bestand die Bevölkerung Ostösterreichs vorwiegend aus Slawen, im Westen aus Bayern (westlich des Arlbergs aus Alemannen), dazu gebietsweise auch Romanen. Das heißt nicht, dass frühere Bevölkerungen (Kelten, Germanen, Awaren) einfach verschwunden waren; sie können Identität und Sprache gewechselt haben, wie es später auch bei den Slawen und Romanen der Fall war, die im Hochmittelalter (mit Ausnahme vor allem der Kärntner Slowenen) zu Deutschen wurden. Über diese ethnischen und sprachlichen Prozesse wissen wir im einzelnen recht wenig; der Wandel der Sprachverhältnisse kann bis zu einem gewissen Grad aus den komplexen Ortsnamenlandschaften erschlossen werden, die (mit dem Sprachwandel nicht immer gleichzeitige) Veränderung der Selbstzuordnung wird nur ausnahmsweise deutlich erkennbar.
Im Untersuchungsgebiet entstanden immer wieder regionale Ordnungen: die römische Provinz Noricum sowie Teile der Nachbarprovinzen Raetien und Pannonien, wo Carnuntum als Legionslager und Zivilstadt einige strategische und kulturelle Bedeutung hatte; die kurzlebigen Reiche der Rugier, Eruler und Langobarden im Ostösterreich des 5./6. Jahrhunderts; das karantanische Fürstentum im 8. Jahrhundert, in dem sich die slawische Bevölkerung eine politische Struktur gab; und schließlich das Erzbistum Salzburg als kirchliches und kulturelles Zentrum des Ostalpenraumes im 9. Jahrhundert. Die regionalen bäuerlichen Lebensformen überdauerten zum Teil diese Veränderungen. Doch gerieten sie zweimal in den Sog einer expansiven arbeitsteiligen Kultur mit ausgebildeter Schriftlichkeit und hierarchischen Strukturen: am Beginn der Epoche von der klassisch-römischen Zivilisation und im 8./9. Jahrhundert von der christlich-fränkischen Ordnung. Um 900 war die Reichweite und Differenziertheit dieses Kulturmodells aber noch recht beschränkt. Der österreichische Raum blieb noch einige Jahrhunderte lang Peripherie der Zentralräume des lateinischen Europa in Italien und den beiden Frankenreichen. Das Potential der mitteleuropäischen Lage als Durchgangsraum zwischen Deutschland und Italien sowie zwischen West und Ost konnte erst allmählich genutzt werden.
Die Römerzeit im Raum des heutigen Österreich
15 v. Chr.
Der Ostalpenraum kommt unter römische Herrschaft.
Ca. 40
Carnuntum wird Legionslager.
Ca. 114
Vindobona wird Legionslager.
166–180
Markomannenkriege unter Kaiser Marc Aurel
Ca. 190
Gründung des Legionslagers Lauriacum
193
Septimius Severus in Carnuntum zum Kaiser ausgerufen
284–305
Kaiser Diocletian
306–337
Kaiser Constantin der Große
308
Kaiserkonferenz in Carnuntum
Die Ostalpen verdankten ihre überregionale Bedeutung im 1. Jahrtausend v. Chr. vor allem ihren Bodenschätzen. Salzbergbau machte Hallstatt zu einem (heute durch Ausgrabungen gut erschlossenen) Zentrum der danach benannten Hallstatt-Kultur der ersten Jahrtausendhälfte. Später war es vor allem das norische Eisen, das Grundlage der Prosperität der sogenannten La-Tène-Zeit war, einer von den Westalpen bis nach Ostmitteleuropa reichenden Kultur, und in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten römisches Interesse erregte. Vereinzelt wird (etwa bei Polybios ) auch von Goldfunden berichtet. Der Ostalpenraum war vor allem von Kelten besiedelt; das ist eine bereits bei Herodot im 5. Jahrhundert v. Chr. bezeugte Großgruppenbenennung. Wie beim Germanennamen wissen wir aber nicht, ob der ethnographische Sammelname überhaupt als Selbstbezeichnung diente und wenn, wie weit. Identitätswirksamer waren im Ostalpenraum wohl die Stammesnamen und regionalen Bezeichnungen, die in römischen Berichten erwähnt werden und zum Teil von Flüssen abgeleitet sind (z. B. Ambidravi an der Drau, Ambisontes wohl an der Salzach). Der Name der Breonen im Tiroler Oberinntal ist über die Spätantike bis ins 9. Jahrhundert bezeugt. Besondere Bedeutung bekamen die seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. belegten Noriker; ein religiöses, vermutlich auch politisches Zentrum lag am Kärntner Magdalensberg, wo eindrucksvolle Überreste ergraben wurden. Das regnum Noricum gelangte durch den Bergbau zu Reichtum und spielte bald eine dominierende Rolle im Gebiet südlich des Alpenhauptkammes und darüber hinaus bis zur Donau. Es war durch einen Freundschaftsvertrag an Rom gebunden.
Im Verlauf des 1. Jahrhunderts v. Chr. geriet das Gebiet des heutigen Österreich von zwei Seiten unter Druck. Der Ausbau der römischen Position in Norditalien seit der Gründung der Kolonie Aquileia im Jahr 181 v. Chr. beeinflusste die politischen Verhältnisse im Alpenraum. Von Nordwesten her breiteten sich neue Gruppen aus, die man in Rom seit Caesar Germanen nannte. Der Zug der Kimbern durch die Ostalpen im Jahr 113 v. Chr. mit der Schlacht beim schwer genau lokalisierbaren Noreia blieb noch Episode. Nachhaltiger wirkte das Zurückweichen der Boier aus Böhmen an die mittlere Donau im frühen 1. Jahrhundert v. Chr., das sie um die Jahrhundertmitte auch in Konflikt mit dem Dakerreich des Burebista brachte, der mit ihrer Niederlage und dem Abzug der meisten Boier endete. Das zunehmende Engagement Roms am Rhein und die Konfrontation mit den Germanen warfen auch die Frage nach einer besseren Kontrolle der Wege durch die Alpen auf.
Читать дальше