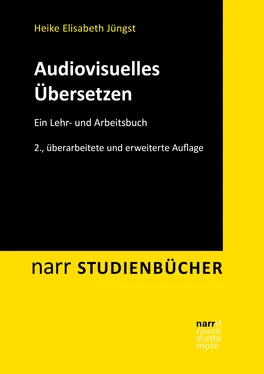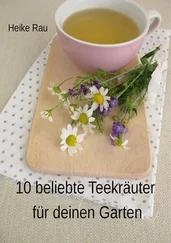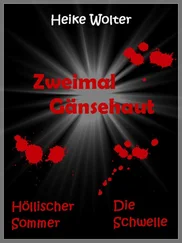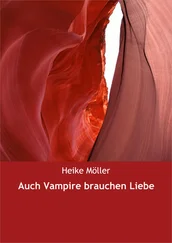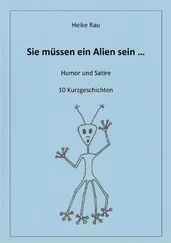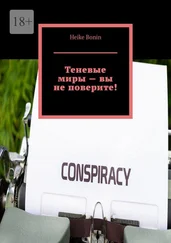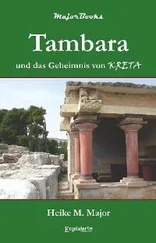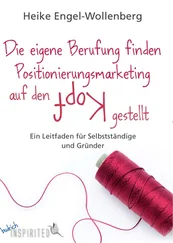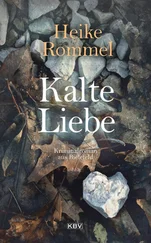Meist konzentriert sich die Diskussion Synchronisation versus Untertitel jedoch auf ästhetische Belange und auf Fragen der Filmwahrnehmung.
Die Debatte, ob Synchronisation oder Untertitelung per se besser sind, wurde schon 2004 von Gambier in die typischen, immer wiederkehrenden Elemente zerlegt. Für die Untertitelung sprechen demnach folgende Argumente
Les avantages et inconvénients qui reviennent le plus souvent font comme un jeu de miroir: ce qui est perçu comme un plus pour le sous-titrage est un moins pour le doublage, et inversement. Sont donnés ainsi en faveur du sous-titrage: il est bon marché car rapide à faire, peut servir pour tout programme AV, respecte l’intégralité de la bande sonore originale, permet l’accès à deux ou trois langues en même temps, facilite l’apprentissage des langues. Le doublage, au contraire, serait cher car laborieux et lent à réaliser; il serait réservé au cinéma, perdrait l’original et n’offrirait qu’une seule langue; il favorisait la domestication, quand il n’est pas simplement manipulation; en plus, ce sont souvent les mêmes voix qui reviennent d’un film à l’autre …
Doch auch die Synchronisation hat Vorteile, die von ihren Verfechtern ins Feld geführt werden:
A ces aspects, s’ajoutent néanmoins des facteurs positifs: le doublage respecte l‘image sur laquelle peut se concentrer le spectateur; il conserve l’oralité, tout en étant soumis à la synchronie labiale; il donne accès au dialogue pour les personnes qui ont des problèmes de lecture (jeunes enfants; immigrants recents; illettrés; etc.) A l’oppose, le sous-titrage est plutôt génant pour ceux qui ont des problèmes de vision ou de lecture; il absorbe une partie de l’écran; il disperse l’attention entre images, lignes écrites et bande son; il réduit les dialogues dans le passage de l’oral à l’écrit et dans sa subordination à un certain espace-temps. Dans cette querelle récurrente, on asserte plus souvent ses arguments qu’on n’apporte des preuves. (Gambier 2004: 267)
Dieser schon vor 15 Jahren erschienenen Zusammenfassung ist wenig hinzuzufügen; es gibt zwar inzwischen qualitative und quantitative Untersuchungen zur Wahrnehmung beider Verfahren, aber die Debatte hat sich außerhalb der Wissenschaft in präzise dieser Form erhalten.
Hier soll der Vollständigkeit halber noch ein ausgesprochen ungewöhnliches Argument für die Untertitelung angeführt werden2:
In contrast to the advantage of being able to follow dubbed programmes via the soundtrack, there is the disadvantage that the sound of the television may be overwhelmed by other sounds in the room, such as the noise of conversations held by members of the family. In noisy environments, subtitled programmes are of course easier to follow than dubbed television programmes. (Koolstra et al. 2003: 332)
Und ein sehr leidenschaftliches für die Synchronisation:
Doch Untertitel, also die Transponierung vom Phonetischen ins Grafische, sind keine ernsthafte Alternative [zur Synchronisation], denn sie lenken von der visuellen Ebene ab und damit von der elementarsten Komponente des Mediums Film: dem Bild. Sie lösen erst recht die Einheit von Bild und Dialog auf, indem sie die Konzentration auf das Gesprochene (bzw. Geschriebene) zu Lasten des Filmischen erfordern und die BildkompositionBildkomposition durch ein zusätzliches Medium, den schriftlichen Text, verändern oder gar zerstören. Man stelle sich eine absichtlich düster gestaltete Sequenz vor, in der ständig helle Untertitel aufblitzen! (Bräutigam 2009: 28).
Man kann ganz salomonisch sagen, dass beide Verfahren gut sind, wenn sie gut gemacht werden. Koolstra weist auf die Gefahr hin, das Verfahren selbst mit einem schlechten Beispiel des Verfahrens zu verwechseln:
In addition, it must be noted that sometimes dubbing or subtitling is also criticized using ‚false‘ arguments pertaining to the mere fact that the original foreign-language texts are badly translated. (Koolstra et al. 2003: 326)
Untertitel können Zuschauern das Gefühl geben, die Übersetzung besser unter Kontrolle zu haben. Hier schlägt sich das Unbehagen vieler Menschen nieder, dass man im Alltag in vielen Situationen auf Übersetzungen angewiesen ist (dazu Koolstra et al. 2003: 327). Das ist nicht auf die AV-Übersetzung beschränkt; niemand kann jeden interessanten Film im Original verstehen.
1.5 Exkurs: Filmgestaltung
Viele Übersetzer haben sich noch nie mit Fragen der Filmgestaltung und Filmanalyse befasst. Einige grundsätzliche Begriffe sind aber wichtig, wenn man Filme verstehen und entsprechend sinnvoll bearbeiten will.
Die visuelle Seite des Films ist eine wichtige Komponente bei der audiovisuellen Übersetzung. Die Übersetzung darf nie den Film stören; bei Untertiteln kann das schnell passieren, wenn man sich nie mit Filmgestaltung beschäftigt hat. Man kann nur mit entsprechenden Kenntnissen mit den anderen Teammitgliedern oder Forschern präzise über Filme und über manche Probleme der audiovisuellen Übersetzung sprechen. Außerdem wird der Blick auf den Film geschärft, was einer professionellen Übersetzung ebenfalls gut tut.1
Ein wichtiges Element der Bildgestaltung ist die EinstellungsgrößeEinstellungsgröße. Sie definiert, was man im Bildausschnitt sieht. Ist die Kamera nah dran am Geschehen oder ist sie eher weit entfernt? Sehen wir kleine Menschen in einer weiten Landschaft oder ein bildschirmfüllendes Gesicht? Unterschiedliche KameraeinstellungenKameraeinstellung machen unterschiedliche Vorgehensweisen bei den Verfahren der audiovisuellen Übersetzung nötig. Als Beispiel sei nur die Nahaufnahme eines Gesichts genannt. Hier sieht der Zuschauer die LippenLippen in vielfacher Vergrößerung. Die Synchronisation muss also sehr genau sein. Aber auch für die Untertitelung birgt die Nahaufnahme Tücken: Die Untertitel sollen möglichst wenig von einem ausdruckstragenden Gesicht verdecken, schon gar nicht die Mundpartie, und ÜbertitelÜbertitel gehören nicht auf die Augen.
Im Allgemeinen werden im deutschsprachigen Raum acht Einstellungsgrößen genutzt und so auch im DrehbuchDrehbuch markiert. Ein Großteil der Literatur zur audiovisuellen Übersetzung ist jedoch englischsprachig, und die englischen Bezeichnungen werden auch gern im Deutschen verwendet. Daher sollte man sie zumindest passiv kennen, auch wenn man mit anderen Sprachen arbeitet. Die Verwendung von deutschen und englischen Bezeichnungen parallel kann problematisch sein, denn je nach Quelle werden die einzelnen Einstellungen unterschiedlich gegeneinander abgegrenzt:
|
Beschreibung |
Englische Bezeichnung |
| Weit (W) |
Landschaft im Überblick, Menschen winzig. Eher im Kino anzutreffen als im Fernsehen. |
extreme long shot oder VLS: very long shot oder manchmal LS: long shot |
| Totale (T) |
Auch hier sind die Menschen noch klein, die Umgebung spielt eine wichtige Rolle. Eine gesamte Szene wird im Bild erfasst. |
LS: long shot |
| Halbtotale (HT) |
Menschen erscheinen von Kopf bis Fuß im Bild. Man nimmt sowohl den Menschen als auch sein Umfeld wahr. |
oft ebenfalls LS: long shot |
| Amerikanisch (A) |
Man sieht die obere Hälfte des Menschen einschließlich des Colts. |
American |
| Halbnah (HN) |
obere Hälfte des Menschen bis zur Hüfte |
MS: mid-shot |
| Nah (N) |
Hier sehen die Menschen praktisch aus wie Büsten. Bei der Mitte des Oberkörpers ist Schluss. |
MDU: medium close-up |
| Groß (G) |
… und jetzt ist nur noch der Kopf zu sehen. |
CU: close-up |
| Ganz groß oder Detail (D) |
Bei einem Menschen ist jetzt nicht mehr das vollständige Gesicht zu sehen, vielleicht nur noch die Augen. Auch kleinere Gegenstände können so hervorgehoben werden. |
BCU: big close-up |
Tabelle 1:
Читать дальше