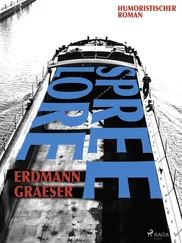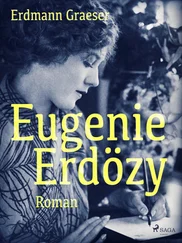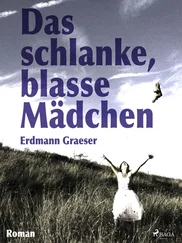Erdmann Graeser
Roman
Einer Berliner
Familie
Saga
Koblanks Kinder
© 1989 Erdmann Graeser
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711592472
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com– a part of Egmont, www.egmont.com
Der Garten in der Bülowstraße war klein geworden – war klein geworden durch die dichten Gebüsche, die die Wege so schmal gemacht, daß die dicke, behäbige Frau Koblank sie völlig versperrte, wenn jemand an ihr vorbei zur Laube wollte.
In der Mitte des viereckigen Platzes hatte ihr Mann – damals, vor fünfundzwanzig Jahren, als er eingezogen war – ein junges Apfelbäumchen gepflanzt; das war nun ein dicker Stamm, dessen Äste den ganzen Rasen überschatteten. Eine grüne Holzbank stand dort, auf der Frau Koblank lieber saß als in der Laube, in der es nach ihrer Ansicht zu viele Mücken gab. Auch Fräulein Elli, die Stieftochter, konnte man hier öfter sehen, zumeist mit einem Buch, denn sie »schmökerte den ganzen Tag«, wie die Leute im Hause sagten.
Von den Mietern, die hier gewohnt hatten, als Koblanks Kinder noch in die Schule gingen, war fast keiner mehr da – die meisten waren fortgezogen, als hinter dem Nollendorfplatz ein ganz neuer Stadtteil entstanden war, mit Häusern, die einen »Aufgang nur für Herrschaften« hatten, mit Wohnungen, die Badestuben und Mädchengelasse besaßen. Und einen von den Alten hatte der Tod geholt: Großvater Koblank war eines Herbsttages sanft und selig in seinem Lehnstuhl entschlafen und ruhte längst neben der ersten Frau seines Sohnes, neben »Auguste Koblank, geb. Zibulke«, in der Familiengruft auf dem Friedhof in der Kolonnenstraße. »Die Liebe höret nimmer auf!« stand unter seinem Namen. Der Grünkramkeller unten im Hause, dieses Klatschnest, war auch verschwunden. Ein Wildbrethändler wohnte jetzt dort, vor dessen Tür am Messinghaken ausgeweidete Rehe, Fasanen und Hasen hingen, von denen noch das Blut abtropfte, was für die Hunde der Bülowstraße ein besonderer Anreiz war, dem Koblankschen Hause häufige Besuche abzustatten.
Zu Ostern oder Pfingsten, immer nur einmal im Jahre, kam Großvater Zibulke, um den Weihnachtsbesuch seiner Enkelkinder zu erwidern. Ja – er lebte immer noch, war ein kleines, vertrocknetes Männchen mit einem Rattengesicht geworden, das seiner Redensart: »Kenn’ ick, weeß ick!« treu geblieben war. Nach dem Tode seiner Frau lebte er nun ganz einsam in dem alten Hause der Lindenstraße. Alle Versuche, ihn hier in der Bülowstraße aufzunehmen und zu verpflegen, scheiterten an seinem Eigensinn. »Det jibt bloß Stunk, und ick will keenen mehr haben vor meinem Tode, ick hab’ jenug jehabt!« hatte er jedesmal abgewehrt, bis man es endlich aufgegeben, ihn umzustimmen.
»Dann nicht!« hatte ihm Herr Koblank erleichtert beigepflichtet. Er war stets zufrieden, wenn keine Veränderungen eintraten, denn nichts ging ihm über das ruhige Geleise, in das sein Leben allmählich geraten. Noch war sein Gesicht frisch und rot, aber das Haar erbleicht und der dicke, runde Vollbart grau geworden. Sonntags, wenn er mit Rösken, seiner Frau, und der Tochter Elli in den Tiergarten spazieren fuhr, um in Charlottenhof Kaffee zu trinken, glich er einem der pensionierten Militärs der Potsdamer Vorstadt; aber wochentags, auf dem Kohlenplatz, wurde er das Pendant zu Onkel Anton, seinem treuen Helfer, den man in der ganzen Gegend nur »das olle Original« nannte. Nein, wochentags gab Herr Koblank nicht viel auf seinen äußeren Menschen, zum Kummer seiner Frau ließ er sich manchmal verkommen. »Dann jeh’ ich sonntags als Fönix aus meiner Asche vor«, sagte er, um sie zu trösten.
Der Kohlenhof am Nollendorfplatz war nun ganz von den hohen, schwarzen Brandmauern der ringsum erbauten Mietskasernen eingeschlossen, das Wiesengelände dahinter verschwunden, der Faule Graben zugeschüttet. Eine Dampfstraßenbahn ratterte durch die Maaßenstraße nach der ehemaligen Wilmersdorfer Chaussee hinauf, und die vorhandenen Reste der Wiesen wurden durch Straßenaufschüttungen eingeteilt und bald abgezäunt. Da und dort stand noch ein alter Weidenstumpf, ein Erlengebüsch, war eine Grabenvertiefung, trippelte auch wohl ein Haubenlerchenpärchen verwundert auf dem ungewohnten Steinpflaster, flüchtete dann aber bei Annäherung von Sonntagsspaziergängern, die das Neuland besehen kamen, scheu in die Laubenkolonien, die da und dort auf dem tiefer gelegenen Terrain jetzt entstanden waren.
Theo Koblank wurde es schwer, die Stelle wiederzufinden, wo einstmals der hohe Weidenbaum stand, in dessen Gabelästen er so oft mit seinen Freunden gesessen hatte. Eines Tages, als er nach langer Zeit wieder einmal hinausgekommen, war der Baum spurlos verschwunden gewesen, wie »Rotkopp«, der sagenhafte Geist dieser Gegend, den jetzt niemand mehr kannte als Fritze Seifert, Theos bester Freund.
Seifert hatte zu derselben Zeit sein Abiturientenexamen gemacht, als Theo mit Ach und Krach auf dem Realgymnasium die Versetzung nach Prima erreichte. Und als nun Fritze Seifert, der Sohn eines ehemaligen Majors, in die Pepiniére übersiedelte, um dort seine Ausbildung als Militärarzt zu empfangen, hatte Theo in rascher Entschlossenheit erklärt, nun auch nicht länger mehr zur Schule gehen zu wollen. »Ich will Zahnheilkunde studieren und Zahnarzt werden!«
»So – und deswegen biste so lange auf die hohe Schule jejangen?« hatte Herr Koblank ärgerlich gefragt.
»Du weißt nicht, was Zahnarzt ist, Vater«, hatte Theo in überlegener Ruhe erwidert. »Zahnarzt kann nur einer werden, der diese Vorbildung besitzt! Ich könnte ja auch Tierarzt werden – aber Zahnarzt ist mir lieber!«
»Na, denn werd Zahnarzt, aber jeder Barbier kann Zähne ziehen, ohne bis Oberprima jekommen zu sein!«
»Das verstehst du nicht besser!«
»Werd nicht wieder frech!«
»Mit dir kann man nicht sprechen, ohne daß du einen anbrüllst, das bist du so vom Kohlenplatz gewöhnt!«
»Zankt euch nicht – schreit nicht so!« hatte Frau Koblank aus der Nebenstube gerufen. »Wat sollen die Leute von uns denken, wenn det heute, am Sonntagmorgen, schon wieder losgeht! Ick hab’ noch von vorigen Sonntag jenuch!«
Sonntags war immer der Tag, an dem die Gegensätze in der Familie aneinandergerieten, denn sonntags blieb Herr Koblank daheim und holte nach, was er in der Woche versäumt. Er hatte dann eine Vorliebe, kleine Reparaturen in der Wohnung vorzunehmen, Nägel einzuschlagen, abgebrochene Stuhlbeine anzuleimen, das ganze Haus bis auf den Boden hinauf nach Schäden abzusuchen. Keinem Mieter war dann wohl, mit Herrn Koblank zusammenzutreffen, ihm ein Anliegen vorzutragen, denn »er machte stets Krach«! Am schlimmsten war es, wenn er mit seinem Sohn zusammengeriet, den man seit ein paar Jahren in die auf demselben Absatz liegende Hofwohnung einquartiert hatte. Diese Wohnung bestand nur aus zwei Stuben und Küche. Die Küche diente als Rumpelkammer. In der ersten Stube war Herrn Koblanks immer größer gewordene Bibliothek, in der zweiten Theos Möbel untergebracht worden. Dort lebte er nun, seitdem er Student geworden, abseits von der Familie, kam nur mittags zum Essen oder spätnachts heim. Und das nannte er zum Ärger seiner Mutter »früh«, denn oft genug, wenn die Kneiperei zu lange gedauert, sah man ihn im Morgengrauen die Hintertreppe hinaufwanken, zuweilen geführt vom Bäcker jungen, einmal auch von einem Milchmädchen, das sich aber seitdem nie wieder zu diesem Dienst bereit finden ließ, trotzdem der Herr Student das Mädchen »kleine Salatschnecke« genannt hatte.
Читать дальше