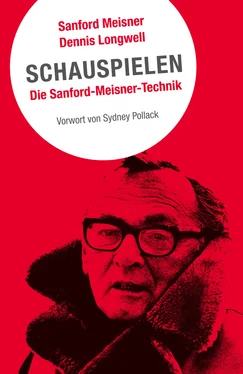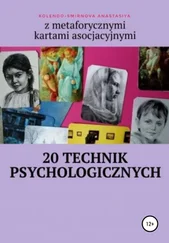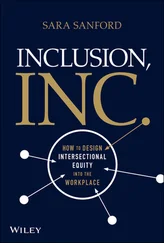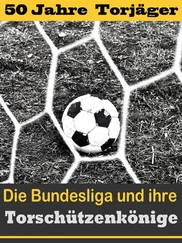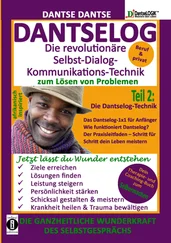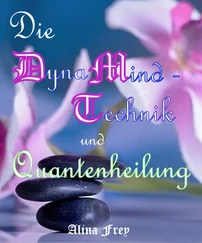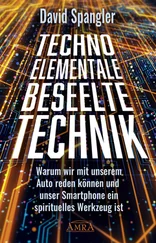1962 kehrte Meisner nach New York zurück, um den Fachbereich Schauspiel der neu gegründeten American Musical Theatre Academy zu leiten. Zwei Jahre später kehrte er ans Neighborhood Playhouse zurück, wo er bis heute unterrichtet. 6 6 Bei Erscheinen des Buches 1987 war Meisner 81 Jahre alt. Er unterrichtete bis 1990 am Neighborhood Playhouse. (Anm. d. Red.) 7 Brassaï (eigtl. Gyula Halász, 1899–1984), französischer Fotograf ungarischer Herkunft. (Anm. d. Red.) 8 In: Shepherd, a. a. O. 9 George Bernard Shaw in der Saturday Review, 15. Juni 1895.
Das Playhouse ist inzwischen sein Heimathafen gewor den, wie es das schon vor fünfzig Jahren war, als er erstmals dort unterrichtete und seine Berufung im Programmheft zu Johnny Johnson verkündete – vielleicht in ähnlicher Weise, wie er damals mit gerade einmal neunzehn Jahren seiner fassungslosen Familie beim Abendessen mitteilte, er wolle Schauspieler werden.
Heute, mehr als sechzig Jahre später, haben sein fortgeschrittenes Alter und einige Unfälle Meisner massive körperliche Einschränkungen auferlegt. Seit er sich wegen des Grauen Stars und Netzhautablösungen an beiden Augen mehreren Operationen unterziehen musste, trägt er eine dicke Brille. Noch verheerender waren die beiden Operationen, die er aufgrund von Kehlkopfkrebs über sich ergehen lassen musste, die erste davon bereits vor über zehn Jahren, und die ihn im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos zurückließen. Unter großen Mühen lernte er danach das Sprechen wieder neu, indem er Luft in die Speiseröhre einatmet und diese als kontrolliertes Rülpsen wieder ausströmen lässt. Wenn man diese Ösophagussprache zum ersten Mal hört, kann sie verstörend wirken, doch man gewöhnt sich als Zuhörer schnell daran. Es klingt wie ein seltsam geisterhaftes, von explosiven Konsonanten und Knacklauten sowie gelegentlichen Hustenanfällen durchsetztes Keuchen. Wenn Meisner heute unterrichtet, wird seine »Stimme« mit Hilfe eines Mikrofons verstärkt, das am linken Brillenbügel befestigt und mit einem kleinen Sender verbunden ist. Dieser überträgt die Worte an einen Lautsprecher auf der anderen Seite des Raumes, gegenüber von Meisners Pult, was den geisterhaften Eindruck noch verstärkt. Und als wären das noch nicht genug Schicksalsschläge, wurde er vor drei Jahren auch noch beim Überqueren der Straße von einem außer Kontrolle geratenen Lieferwagen erfasst und trug einen zwölffachen Bruch am linken Oberschenkel und an der linken Hüfte davon. Nach den notwendigen Operationen kann er nur noch mit Hilfe eines Stockes gehen. Die Sommermonate und den tiefsten Winter verbringt er inzwischen nicht mehr in New York, sondern in einem Haus, das er sich zusammen mit seinem engen Freund James Carville vor zwanzig Jahren auf der Insel Bequia in der Karibik gebaut hat. Das warme Klima und Wasser der Tropen sind Balsam für ihn.
Und dennoch unterrichtet Meisner weiter. In seiner Vorstellung, so hat er es einmal in einem Interview erzählt, sieht er sich wie einen »bekannten Maler« (er meint damit den französischen Künstler Raoul Dufy, vermutlich so, wie er auf dem berühmten Foto von Brassaï 7 7 Brassaï (eigtl. Gyula Halász, 1899–1984), französischer Fotograf ungarischer Herkunft. (Anm. d. Red.) 8 In: Shepherd, a. a. O. 9 George Bernard Shaw in der Saturday Review, 15. Juni 1895.
bei der Arbeit zu sehen ist). »Als er über achtzig war, hatte die Arthritis seine Hände derart verformt, dass er den Pinsel nicht mehr halten konnte. Da bat er jemanden, ihm den Pinsel irgendwie an der Hand zu befestigen, und hat weitergemalt. Ich kehre jetzt, mit all meinen Einschränkungen – ich kann schwer sprechen, ich sehe schlecht –, in diese eisige Stadt zurück, um wieder zu unterrichten! Manche glauben, man hätte mich dazu überredet. Aber das stimmt nicht. Man kann mich zu nichts überreden, was ich nicht will. Und ich will das. Wenn ich unterrichte, bin ich am glücklichsten.« 8 8 In: Shepherd, a. a. O. 9 George Bernard Shaw in der Saturday Review, 15. Juni 1895.
Vielleicht liegt der Grund ja in dem Wunder, das Harold Clurman beschreibt, dem »fast schon heiligen« Wunder wahrhaftiger Emotionen. Oder er hat seine Wurzeln in Meisners Bemerkung über das Genie der Pauline Lord: »Durch sie erkannte ich allmählich, dass ich nach einer Art des Schauspielens suchte, die mich wirklich berührt.«
»Habe ich Ihnen schon mal die Geschichte von Eleonora Duse erzählt?«, fragte Meisner kürzlich einen Besucher in seinem Büro. »Wirklich nicht?« Nachdem er sich noch einmal versichert hatte, berichtete er von George Bernard Shaws Kritik über die legendäre italienische Schauspielerin 1895 in dem Stück Heimat von Hermann Sudermann (das Stück ist auch unter dem Titel Magda bekannt, der Rolle der Duse). Shaw schrieb damals Folgendes: »Magda ist plötzlich auf sich allein gestellt, weil sie, die Tochter, sich dem Willen ihres Vaters nicht fügen will, einem dieser abscheulichen Charaktere, die den eigenen Drang danach, jeden nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen, mit den geheiligten Grundprinzipien des Familienlebens verwechseln. Sie macht harte Zeiten durch, feiert aber schließlich Erfolge als Opernsängerin, allerdings erst, nachdem ihr einsames Ringen sie trostsuchend in die Arme eines Mitstudenten getrieben hat, der sich alsbald aus dem Staub macht, während sie sich, so gut sie kann, mit der bevorstehenden Mutterschaft arrangieren muss. Auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes kehrt sie in ihren Heimatort zurück und sucht, in einem Anfall von Heimweh, ihren Vater auf, der einwilligt, sie zu empfangen. Kaum ist sie wieder im Haus, muss sie feststellen, dass der Vater ihres Kindes inzwischen ein enger Freund der Familie ist. Im dritten Akt des Stückes wird ihr der Besuch angekündigt […] In dem Augenblick, als das Dienstmädchen ihr die Visitenkarte reichte, wurde dem Zuschauer klar, was es für sie bedeutete, sich einer Begegnung mit diesem Mann gegenüberzusehen. Es war interessant zu beobachten, wie sie es dann doch durchstand und wie es ihr im Großen und Ganzen auch recht gut gelang. Er machte seine Aufwartung und überreichte seine Blumen, sie nahmen Platz, und sie hatte offensichtlich das Gefühl, sicher darüber hinweg zu sein und sich eine gewisse Ungezwungenheit gestatten und ihn anschauen zu können, um zu sehen, wie sehr er sich verändert hatte. Doch dann geschah ihr etwas Furchtbares. Sie errötete, wurde sich dessen im nächsten Moment bewusst, und die Röte breitete sich langsam aus und wurde stärker, bis sie schließlich, nach einigen vergeblichen Versuchen, das Gesicht abzuwenden oder ihn davon abzulenken, ganz aufgab und ihr Erröten in den Händen barg. Nach dieser schauspielerischen Glanzleistung braucht mir niemand mehr zu erklären, weshalb die Duse keine zentimeterdicke Schminke verwendet. Ich konnte keinerlei Tricks erkennen: Es schien mir ganz und gar auf der Wirkung der dramatischen Vorstellungskraft zu beruhen […] und ich muss mich zu der tiefempfundenen beruflichen Neugier bekennen, ob es wohl jedes Mal so spontan gelingt.« 9 9 George Bernard Shaw in der Saturday Review, 15. Juni 1895.
Meisners Zusammenfassung dieser Schilderung ist sehr viel kürzer, in den entscheidenden Details aber korrekt. Mehr noch, seine Begeisterung und sein echtes Staunen über Shaws Geschichte vom Erröten der Duse sind ansteckend, obwohl er die Geschichte schon hundert Mal erzählt hat. Es ist, als wäre die Zeit stehen geblieben und Sanford Meisner könnte sich auf ewig am Wunder dieses Augenblicks erfreuen. Und für einen Moment begreift man, wie dieser außergewöhnliche Mann ein so außergewöhnliches Leben führen konnte.
»Die Duse hat in einem Stück mit dem Titel Magda gespielt, und da gibt es diese eine Szene im letzten Akt. Als junge Frau hatte sie eine Affäre mit einem Kerl, der aus dem gleichen Heimatort stammt, und bekam ein Kind von ihm. Etwa fünfundzwanzig Jahre später kehrt sie zurück, um ihre Eltern zu besuchen, die noch dort leben, und ihr früherer Geliebter macht seine Aufwartung. Sie nimmt seine Blumen – das habe ich alles von Shaw –, und sie setzen sich hin und plaudern. Aber plötzlich merkt sie, dass sie rot wird, und am Ende ist es so schlimm, dass sie den Kopf senkt und verlegen ihr Gesicht versteckt. Das nenne ich eine realistische Darstellung! Und Shaw bekennt sich zu der professionellen Neugier, ob das wohl jedes Mal so klappt, wenn sie diese Rolle spielt. Natürlich nicht. Aber dieses Erröten, das ist der Inbegriff wahrhaftigen Lebens unter imaginären Gegebenheiten, was meiner Definition von gutem Schauspiel entspricht. Dieses Erröten kam aus ihr selbst. Sie war ein Genie!«
Читать дальше