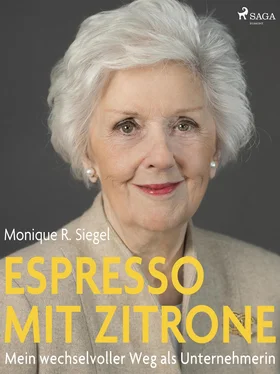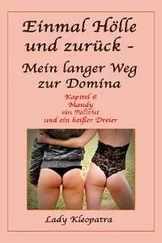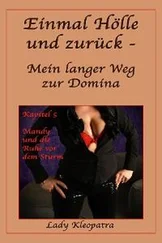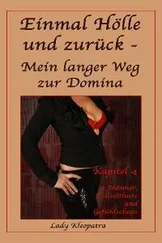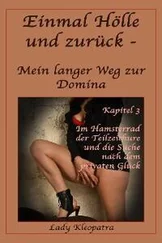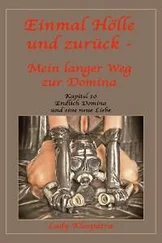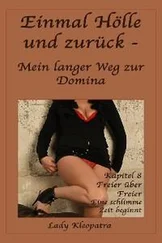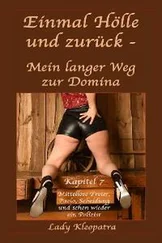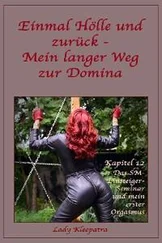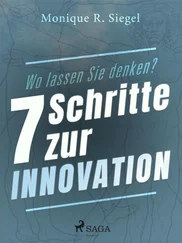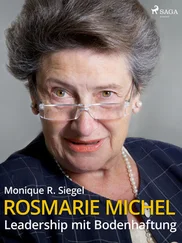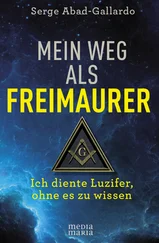Es ist immer noch Nachkriegszeit in Deutschland. Das heißt: Die Verhältnisse sind alles andere als geordnet. Noch immer fehlen Möbel oder Schulbücher, von Landkarten oder Ausstattungen von Biologie- und Chemiezimmern ganz zu schweigen. Die Schulhäuser sind, wo nötig und möglich, notdürftig repariert worden; es mangelt jedoch an allen Ecken und Enden, ganz besonders auch an entnazifizierten Lehrerinnen und Lehrern. Die chaotischen Verhältnisse während des Krieges haben immer noch Folgen; so sind zum Beispiel viele Kinder einiges älter als üblich, und die Klassen sind weit über ihre zulässige Höchstzahl hinaus belegt.
Und in dieser Situation steht da nun dieser Mann und möchte seine achtjährige Tochter anmelden! Der Rektor traut seinen Ohren nicht, erklärt meinem Vater, daß er Dreizehnjährige zurückstellen muß, weil die Klassen übervoll sind, und daher eine Achtjährige null Chancen hat, aufgenommen zu werden. Mein Vater macht ihn darauf aufmerksam, daß ich ja nur noch vier Tage lang acht Jahre alt bin, aber auch Neunjährige sind nicht gefragt. Es würde mindestens noch zwei Jahre dauern, bis sich die Verhältnisse einigermaßen normalisiert hätten.
Offenbar will mein Vater nicht so schnell die Segel streichen, und als er fragt, was er denn mit seiner hochintelligenten kleinen Tochter tun soll, sieht der Rektor seine Chance, uns endgültig loszuwerden. Da gebe es ja noch eine Mittelschule (würde heute der Schweizer Sekundarschule entsprechen); dorthin würden sie all die abschieben, die es auf der Höheren Schule nicht schafften. Vielleicht würden die mich aufnehmen. Ich verstand das nur bedingt, denn vor dem Abschieben hätte ja zumindest eine Aufnahme erfolgen sollen, aber mein Vater erkundigt sich bereits nach der Adresse der Schule, die für mich in Frage käme; der Rektor liefert sie bereitwilligst. Wir würden es dann in zwei Jahren noch einmal versuchen, meint nun mein Vater. Der Rektor ist offensichtlich genervt von diesem Mann, und er dehnt seine Ablehnung auf mich aus. »Machen Sie sich da mal keine Hoffnung«, meint er zum Abschied mit kaum verhohlenem Hohn, »es hat noch keine geschafft, von der Mittelschule aufs Lyzeum zu kommen – der Weg geht in die umgekehrte Richtung!« Er hätte mir keinen größeren Motivationsschub vermitteln können; ich bin ihm heute noch dankbar dafür.
Die Aufnahmeprüfung für die Mittelschule war nicht schwer und die Tatsache, daß ich die Jüngste in der Klasse war, nicht neu. Ich gewöhnte mich schnell daran, daß ich hier wieder einmal Bestnoten liefern mußte – nicht nur, um meinen Vater zufriedenzustellen, sondern weil mich keiner auch nur für einen Moment vergessen ließ, daß ich ja nur für zwei Jahre ein Gastspiel geben wollte. Wenn ich wirklich den Weg zurück einschlagen wollte, den angeblich niemand erfolgreich beschreiten könnte, durfte ich nicht nachlassen. Leistung war also gefragt.
In die Zeit der Mittelschule fallen ein paar wichtige Ereignisse: Zum Beispiel der Beginn der Arbeitslosigkeit meines Vaters und, im Juni 1948, die Währungsreform, Beginn des deutschen Wirtschaftswunders. Die ersten Erfahrungen mit Heimarbeit und die ersten Lektionen einer Sprache, die einmal Anspruch erheben würde, mir meine Muttersprache zu ersetzen. Die Freundschaft mit der Bäckerstochter und die Geschichte mit den Schuhen meines Vaters. Der Vorfall mit dem Priester und mindestens zwei abortierte Schwangerschaften meiner Mutter. Es war eine Zeit des Lernens und Erfahrens, auch außerhalb der Schule. Aber nun mal hübsch eins nach dem anderen ...
Im Grunde war die Mittelschule nicht die schlechteste Schulzeit. Mein Schulweg dauerte eine Dreiviertelstunde mit der Straßenbahn oder gut zwanzig Minuten mit dem Fahrrad. Eine Zeitlang hatte ich ein Fahrrad, ein älteres Modell natürlich, nicht mehr solch ein schönes, rotes, nagelneues wie in Ostpreußen. Wie ich dazu gekommen bin, weiß ich nicht mehr, aber es hat mir sehr gute Dienste geleistet. Und eben: Natürlich konnte ich radfahren, sobald mein Vater es mir nicht mehr beibringen wollte.
Leider wußten alle in der Klasse, daß ich nicht die Absicht hatte, dort Wurzeln zu schlagen, und so mußte ich mich erst einmal bewähren und mich als verläßlich erweisen, bevor ich akzeptiert wurde. Dann aber machte wiederum das Lernen Spaß, besonders der Englischunterricht. Ich weiß nicht, was es war mit dieser Sprache – vielleicht die positiv besetzte Erinnerung an den jungen Amerikaner, der mich verwöhnt und meine Mutter angehimmelt hatte, oder Uncle Fred? –, aber vom ersten Tag an war ich ihr verfallen. Mit Ausnahme von Deutsch ist mir nichts je so leicht gefallen wie Englisch. Es waren die schönsten Stunden; gleich danach kam Aufsatz schreiben. Mit Rechnen, das nun schon Mathematik hieß, hatte ich immer noch nichts im Sinn, und das würde auch für den Rest meines Lebens so bleiben. Aber ich hatte auch Geschichte oder Geographie sehr gerne und konnte mich mit dem Lehrplan gut arrangieren. Die Hausaufgaben waren jetzt anspruchsvoller, und oft machte ich sie zusammen mit anderen Kindern nach der Schule. Zu mir nach Hause konnte ich natürlich niemanden einladen; als sich doch einmal eine Mitschülerin bei uns einfand, mußte ich dafür einen unverhältnismäßig hohen Preis zahlen.
Die Mitschülerinnen hatten schnell begriffen, daß sie bei mir die eine oder andere Lösung holen konnten. Und sie wußten auch, wie man mich dazu kriegen konnte: mit Pausenbroten zum Beispiel. Ich hatte immer Hunger und lernte zu essen, wann immer sich dazu Gelegenheit ergab. Zu der Zeit war ich noch hoch aufgeschossen und brandmager, später, nach der Pubertät, würde sich das dann in unnötigen Kilos niederschlagen. Noch aber war ich ein dünnes, hungriges Kind – mit einer Bäckerstochter als Freundin! Ediths Vater hatte eine gutgehende Bäckerei, aber keine so intelligente Tochter. Sie war dankbar, wenn ich ihr bei den Hausaufgaben half, und ich besuchte sie, so oft ich konnte, denn ich durfte das Haus durch die Backstube betreten! Dort konnte ich mich bedienen mit allem, was mein Herz begehrte bzw. was meine Hände auf dem Weg zum ersten Stock noch halten konnten. Ich fand Edith großartig, denn sie ließ mich nicht nur essen, sondern hie und da durfte ich dort auch baden, was mir das Höchste an Luxus schien.
Dann aber bekam das Bild einer harmonischen Schulzeit doch einen Riß, der alles verändern würde. Ich war in jeder Beziehung gewachsen und hatte inzwischen Schuhgröße dreiundvierzig. Als sich das einzige Paar Schuhe, das ich besaß, in Wohlgefallen auflöste und ich eines Morgens effektiv mit Schuhfetzen dastand, mußte eine Lösung her. Mein Vater hatte dieselbe Schuhgröße, und obwohl ich heftigst protestierte, mußte ich seine Schuhe anziehen und damit zur Schule gehen.
Wir alle kennen Geschichten von der Grausamkeit von Kindern – bitte glauben Sie, was immer Sie hören! Ich war das Gesprächsthema des Tages! Von dem Moment, wo ich auf den Schulhof radelte, bis zum Ende des Unterrichts ließen mich meine Mitschülerinnen nicht vergessen, was da wie Klumpen an meinen Füßen hing. Als ob ich das hätte vergessen können; die schweren Herren-Halbschuhe hingen an meinen dünnen Beinen und machten jeden Schritt zur Qual. Das Interessante ist, daß sich die Alternative eines verpaßten Schultags offenbar gar nicht gestellt hat; wahrscheinlich haben wir irgendeine Klassenarbeit geschrieben, die ich nicht verpassen konnte oder wollte.
Bis zum Nachmittag hatte meine Mutter genügend Geld aufgetrieben – wir waren jahrelang Stammkunden bei den Pfandleihen –, um mit mir einen Schuhladen aufzusuchen. Die Verkäuferin fiel fast in Ohnmacht, als sie meine Schuhgröße hörte. Nach langem Suchen fand sie dann doch ein Paar Schuhe, für das unser Geld reichte. Die hatten nur einen Schönheitsfehler: Sie waren Größe zweiundvierzig. Die Verkäuferin redete auf uns ein, daß wir in ganz Deutschland keinen Kinderschuh in meiner Größe fänden (womit sie zweifellos recht hatte) und froh sein sollten, daß sie noch etwas gefunden hatte. Mit dem zur Verfügung stehenden Geld hatten wir ohnehin keine Wahl, und der nächste Schultag kam bestimmt. Ich hatte zwar einen Vormittag in den Schuhen meines Vaters verbracht, aber ich hatte keinen Zweifel daran gelassen, daß ich dieses Spießrutenlaufen nicht noch einmal über mich ergehen lassen würde. Also kauften wir diese Schuhe, die natürlich weh taten. Meine Zehen haben das offenbar nicht so geschätzt, daß sie sich den Schuhen anpassen mußten – die Spuren von einer solchen Prozedur bleiben einem ein ganzes Leben lang.
Читать дальше