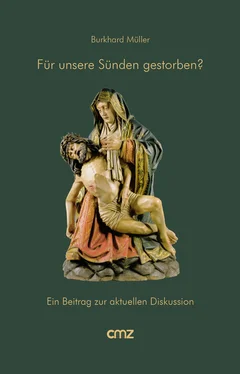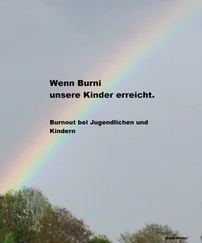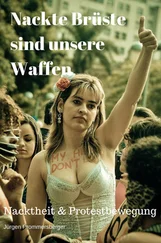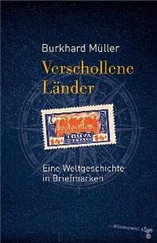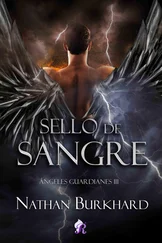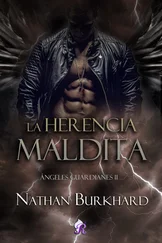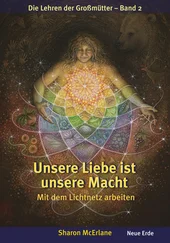Viele sehen im Psalm 2 eine Liturgie der Ernennung des Königs und seiner Adoption zum Sohn Gottes. Mit dem Satz »Du bist mein Sohn« wurde dem neu gesalbten König durch die Priester die Gottessohnschaft zugesprochen.
(»Ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt: ›Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.‹« Psalm 2,7f.)
Adoption zum Sohn Gottes durch die AuferstehungEs gibt einen sehr frühen Text der ersten Christen, den Paulus in Römer 1,3–4 zitiert:
»Jesus Christus, unser Herr,
geboren aus dem Geschlecht Davids
nach dem Fleisch
und nach dem Geist, der heiligt,
eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft
durch die Auferstehung von den Toten.«
Jesus als Mensch (»nach dem Fleisch«) ist Nachkomme des Königs Davids. (Die Jungfrauengeburt ist hier unbekannt.) Dieser Mensch wird durch die Auferstehung zum Sohn Gottes eingesetzt, »adoptiert«. Jesus, der Mensch, ist also seit Ostern Sohn Gottes.
Adoption zum Sohn Gottes bei der TaufeDer Evangelist Markus erzählt keine Weihnachtsgeschichte wie Lukas oder Matthäus. Er weiß nichts von einer wunderbaren Geburt Jesu. Aber er weiß, seit wann Jesus Gottes Sohn ist. Rechtzeitig zum Beginn seines Wirkens geschieht die Adoption zum Sohn Gottes. Diese Adoption vollzieht sich bei Markus am Jordan, bei der Taufe Jesu durch Johannes den Täufer: Da sieht Jesus (er, nicht die anderen Leute!), dass sich der Himmel auftut. Er hört, wie eine Stimme, Gottes Stimme, vom Himmel spricht. Aber nur Jesus wird angeredet: »Du bist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.« (Markus 1,10f.)
Markus spricht hier zwar schon griechisch, aber seine Vorstellung vom Gottessohn ist noch orientalischaramäisch. Der Gottessohn ist der zum Gottessohn Adoptierte. In der von Paulus zitierten Strophe geschieht das bei der Auferstehung. Im Markusevangelium ereignet sich das bei der Taufe Jesu.
Sohn Gottes seit Beginn des irdischen LebensIrgendwann, ziemlich rasch, kam das Evangelium in eine andere, die griechische Welt. Dort kannte man auch den Begriff »Sohn Gottes«, aber man verstand etwas ganz anderes darunter. Ein Sohn Gottes ist ein göttlicher Mensch ( theios aner ), eine Art Halbgott, z. B. einer, den Zeus im Beischlaf mit einer schönen Frau gezeugt hat. Der Mensch, der dann geboren wurde, war ein Gottessohn, ein Mensch mit wunderbaren Kräften.
Wenn die Menschen der griechischen Welt hörten: »Jesus ist der Sohn Gottes«, dann hätten sie das leicht in dem Schema der griechischen Mythologie missverstehen können: An der Zeugung waren eine Frau und ein Gott beteiligt, der ihr beiwohnte. Aber Jesus ist nicht entstanden wie die vielen Söhne des Zeus aus dem Beischlaf eines Gottes mit einer menschlichen Frau.
Diese Vorstellung war lästerlich bei den Anhängern Jesu Christi. Sie mussten neue Bilder und Geschichten finden, die dieses Missverständnis ausschlossen. Hier half entscheidend die Vorstellung von der Jungfrauengeburt.
Dieser Jesus ist Sohn Gottes nicht durch den Beischlaf Gottes mit Maria, sondern er ist auf andere, auf wunderbare und geheimnisvolle Weise entstanden. Die Geburtslegenden Lukas 1f. und Matthäus 1f. erzählen davon.
»Das Wort ward Fleisch«Das späteste der vier Evangelien, das Johannesevangelium, geht noch weiter zurück mit dem Anfang Jesu. Bei ihm ist Jesus das Wort ( logos ), dessen Leben nicht durch eine wunderbare Geburt beginnt, sondern das von Ewigkeit her bei Gott ist und von Gott heruntersteigt (Johannes 1) und »Fleisch« wird. Auch diese neue Sicht des Johannes ist als das Ergebnis einer Übersetzung in die Vorstellungswelt eines ganz bestimmten Menschenkreises zu erklären.
Es hat im Verlauf der Geschichte der Kirche viele solche Übersetzungen und Veränderungen gegeben. Ich habe großen Respekt vor der intellektuellen und theologischen Leistung, mit der das Evangelium aus der orientalischen Welt in die griechische, dann in die lateinische und germanische Welt übersetzt wurde, so dass es bei uns in unserer Sprache gehört werden kann.
3. Das zweite Fremdwort in dieser Sache: »Inkulturation«
ES WIRD HEUTE häufiger ein anderer Ausdruck gebraucht, der etwas ganz Ähnliches bezeichnet: Inkulturation. Man kann sich das leicht selbst übersetzen: Inkulturation ist das Hineinwachsen des Evangeliums in die Kultur der jeweiligen Zeit oder Gesellschaft, um dort richtig anzukommen und zuhause zu sein. Bei der Inkulturation in unsere Zeit ergeben sich ganz spezifische Probleme. Rudolf Bultmann hat das in den inzwischen klassisch gewordenen Satz gekleidet: »Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geisterund Wunderwelt des Neuen Testaments glauben.« Natürlich gibt es Christen, die das versuchen. Aber viele können das nicht, weil sie nicht mit gespaltenem Bewusstsein leben wollen. Sie brauchen die Inkulturation in unsere Zeit.
Vieles verstehen wir heute andersMisstrauische Menschen sehen in der Inkulturation den Versuch, sich an den Zeitgeist anzupassen. Sie spotten: Wer sich mit dem Zeitgeist verheiratet, ist bald Witwer! Manche sehen darin eine unglaubliche Arroganz des heutigen Menschen, klüger sein zu wollen als die Früheren. Aber dass Inkulturation notwendig ist, müsste jedem einleuchten – schon allein deshalb, weil im Verlauf der Jahrhunderte bestimmte Erkenntnisse gewonnen wurden, die sich auf den Glauben auswirken.
Wir wissen heute: Die Erde ist keine Scheibe. Die Erde ist nicht die Mitte der Welt. Adam und Eva waren nicht das erste Menschenpaar.
Wo ist der Himmel Gottes? Früher, als man die Welt für eine Art mehrstöckiges Haus hielt mit dem Totenreich unter der Erdscheibe und dem Himmel über ihr, konnte man klar sagen: Die Hölle (= Totenreich) ist unten, der Himmel ist oben. Viele haben sich die Himmelfahrt Christi als eine Bewegung nach oben vorgestellt.
Aber jetzt, da wir wissen, dass die Erde eine Kugel und das Weltall unendlich weit ist, muss man eine neue Antwort finden auf die Frage: Wo ist der Himmel Gottes? Und diese Antwort zu finden ist die Aufgabe der Inkulturation. Oder man kann sich Gott als Schöpfer nicht mehr so vorstellen, wie er in 1. Mose 2 beschrieben wird, als eine Art Töpfer, der den Menschen aus einem Erdenkloß formt. Auch nicht so, wie er sonst in unserer Religion oft gesehen wird, als der, der liebevoll alles, was ist, selbst erschaffen hat. Die Evolutionstheorie als eine zeitgemäße Vorstellung von der Entwicklung der Natur zwingt uns, anders von Gott dem Schöpfer und von der Natur als Schöpfung zu reden.
Dabei kann man durchaus zu verschiedenen Ergebnissen kommen. So gibt es Christen, die die Evolutionstheorie nicht akzeptieren, sondern gegen sie eine eigene, scheinbar christliche Lehre aufbauen. Sie behaupten: Es gibt einen »Designer«, der hier und da und überhaupt grundsätzlich alle Entwicklung bestimmt hat.
Wenn ich dagegen mit anderen sage: Die Natur hat sich von selbst entwickelt, aber Gott hat ihr seinen EhrenTitel »Schöpfung« verliehen und uns zu den hoffentlich gewissenhaften Verwaltern dieser Schöpfung gemacht; und wenn ich weitersage: Wir Menschen haben tatsächlich mit den Affen gemeinsame Vorfahren, aber Gott hat uns (anders als die Affen) als seine Kinder »adoptiert« und uns unverlierbare Menschenwürde verliehen – dann sind unsere Standpunkte zwar grundverschieden, aber eines haben sie gemeinsam: Sie sind Inkulturation in die heutige Zeit.
Um Inkulturation kommt keiner herum, auch nicht derjenige, der sich mit allen Kräften gegen die historischkritische Methode wehrt und dagegen die Lehre von der wortwörtlichen Eingabe der ganzen Bibel durch Gott aufrechterhält, so dass er darüber im Extremfall zum gefährlichen Fundamentalisten wird. Das ist auch Inkulturation, anders allerdings als bei demjenigen, der sich von der historischen Forschung, helfen lässt, die Bibel als etwas historisch Gewachsenes besser zu verstehen.
Читать дальше