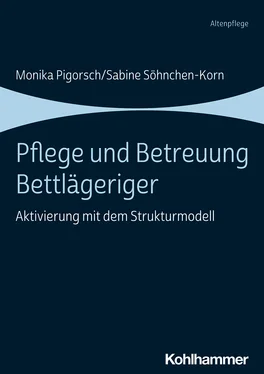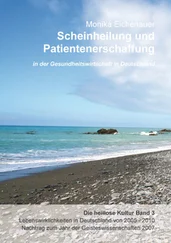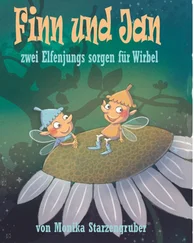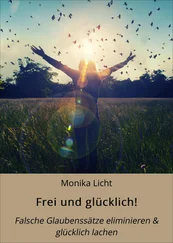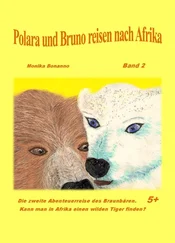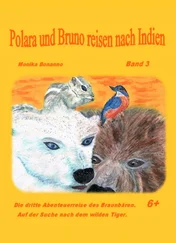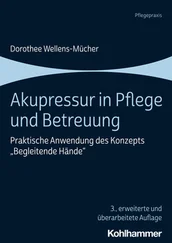Somit ergibt sich von selbst, dass sich Pflege und Betreuung nicht nur auf die körperliche und geistige Ebene beschränken darf, sondern in erster Linie individuelle und persönliche »Beziehungsarbeit« sein muss.
Die Grundvoraussetzung für eine gelungene Beziehung ist die Kommunikation. Neben der verbalen Sprache, die im Krankheitsverlauf oft immer reduzierter möglich sein kann, sollte die Aufmerksamkeit auf die nonverbale Kommunikation gerichtet sein. Darunter wird hier besonders die Beobachtung und der bewusste und reflektierte Einsatz von Mimik, Gestik, Körperhaltung, Tonfall, Atmung und natürlich der Blickkontakt verstanden. Körpersprache ist die Sprache der Gefühle. Sie ist oft authentischer als das gesprochene Wort und wird bis zum Tode »gesprochen« und verstanden.
Gute Pflege ist sicher die erste wichtige Voraussetzung zur Erhaltung des Wohlbefindens, seelische Begleitung aber der zweite, unerlässliche Baustein zur Erhaltung von Lebenssinn und positivem Ich-Gefühl, damit »die Seele vor den Beinen bewegt wird«.
3 Psychische Grundfunktionen
Die psychischen Grundfunktionen sind Parameter für seelische und körperliche Gesundheit/Krankheit und deren Berücksichtigung ist notwendig für die zielgenaue Planung eines Betreuungs- und Beschäftigungsangebotes.
Die relevanten psychischen Funktionsbereiche sind:
• Bewusstsein
• Antrieb
• Affektivität
• Gedächtnis
• Denken
• Wahrnehmung
Im Folgenden werden diese Funktionen kurz beschrieben und mit Hinweisen für die Pflege und Betreuung bettlägeriger Menschen versehen.
Unter Bewusstsein wird das Erleben mentaler Zustände eines Individuums verstanden, die sich aus komplexen neurophysiologischen Prozessen ergeben.
»Es beinhaltet die Grundelemente aller psychischen Abläufe und Funktionen« 1 1 Elisabeth Höwler, Gerontopsychiatrische Pflege, Schlütersche Verlag 2000
und ist die Voraussetzung, um äußere Sinnesreize und innere Prozesse zu verarbeiten.
Bewusstseinsstörungen liegen vor, wenn die Orientierung herabgesetzt und der Wachzustand (Vigilanz) gemindert ist, wodurch das Denken, Handeln und Fühlen des betroffenen Menschen stark beeinflusst wird.
Vigilanzstörungen sind:
• Benommenheit: der Betroffene ist verlangsamt, nimmt die Umgebung nur unpräzise wahr und reagiert entsprechend diffus, die Orientierung ist lückenhaft.
• Somnolenz: der Betroffene ist schläfrig, befindet sich in einer Art Dämmerzustand, reagiert jedoch auf deutliche Ansprache und Berührung.
• Sopor: der Betroffene befindet sich in einem Zustand des Tiefschlafs, reagiert nur noch auf stärkste Reize und ist nur für kurze Momente erweckbar.
• Koma: der Betroffene befindet sich in tiefer Bewusstlosigkeit, reagiert nicht auf Reize, ist nicht erweckbar.
Ist das Bewusstsein herabgesetzt, die Reaktionen verlangsamt und die Orientierung gestört, sollte auf Angebote zurückgegriffen werden, die diese Zustände berücksichtigen und den Mangel lindern. Vielversprechende Betreuungsmöglichkeiten sind hier die Basale Stimulation und das Snoezelen ( 
Kap. 6
– Betreuungskonzepte), bei der die Wahrnehmung über die Sinne angesprochen, gefördert und aktiviert wird.
Der Antrieb ist Voraussetzung für jedes Handeln, Denken und Fühlen und ist bei jedem Menschen individuell ausgeprägt. In der Arbeit mit alten Menschen kennen wir als Auffälligkeiten
• die gesteigerte motorische Unruhe
• den verminderten Antrieb, bis hin zur Apathie.
Der Antrieb ist zunächst eine wichtige Ressource für bettlägerige Menschen. Durch eigenes Aufsetzen, Bewegen, Drehen werden viele Risiken, die das überwiegende Liegen im Bett mit sich bringt, vermieden. Deshalb gehört es zu unserer Aufgabe diese noch vorhandene Aktivität zu erhalten. Wir fördern und unterstützen den Wunsch nach Bewegung zum einen durch aktive und passive Bewegungsübungen, zum anderen durch die Gestaltung des Lebensraums Bett, indem wir Taschen, kleine Regale in unmittelbarer Nähe anbringen, um die Autonomie des Kranken zu erhalten und die Bewegungsabläufe positiv zu beeinflussen.
Bei motorischer Unruhe können wiederum Angebote aus dem Bereich basaler Stimulation eingesetzt werden. Aber auch ein insgesamt verstärkter Betreuungseinsatz kann helfen, die Unruhe in sinnvoll kanalisierte Aktivität umzuwandeln.
Bei stark reduziertem Antrieb ist es unsere Aufgabe, die Apathie zu durchbrechen und den Menschen zu aktivieren. Sehr häufig finden wir gerade unter den bettlägerigen Bewohnern in einer Altenhilfeeinrichtung Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, die sich ins Bett zurückgezogen haben und bei denen kaum noch eigener Antrieb zu erkennen ist. Bei diesem Krankheitsbild hilft uns die Selbsterhaltungstherapie nach Romero ( 
Kap. 6.4
), um das verletzte »Selbst« des Kranken wieder aufzurichten. Der Antrieb kann durch das Finden von Zielen und Sinnhaftigkeit unterstützt und reaktiviert werden.
Der Affekt beschreibt die Grundstimmung eines Menschen, sowie den Ausdruck und Umgang mit aktuellen Emotionen, wie z. B. Freude, Trauer, Wut oder Angst.
Störungen des Affektes, die besonders im Alter auftreten können, sind:
• Affektlabilität: darunter versteht man stark schwankende Stimmungslagen, Lachen und Weinen wechseln sich rasch ab, für Außenstehende oft ohne erkennbaren Grund.
• Affektinkontinenz: hier können die Gefühle nicht beherrscht werden und schon bei kleinen Anlässen überschießen und unangemessen wirken.
• Affektarmut: es werden kaum Gefühle gezeigt, der Betroffene erscheint gleichgültig und teilnahmslos.
• Depressive Stimmungslage: die Erlebenswelt ist negativ eingefärbt, der Betroffene ist lustlos, oft ohne Hoffnung auf Besserung, schwermütig und ist unfähig, positive Gefühle zu erleben. Auch die Gefühle der Leere und Sinnlosigkeit werden häufig beschrieben.
• Dysphorie: stellt einen Zustand von gereizter, missmutiger Stimmung dar, der Betroffene ist mürrisch, durch nichts zufrieden zu stellen, es besteht die Möglichkeit aggressiver Reaktionen.
Bei all diesen Gefühlsäußerungen gilt grundsätzlich, sie ernst zu nehmen und angemessen darauf zu reagieren. Bei dementiell erkrankten Personen ist die Königsdisziplin die Validation, d. h., den Menschen in seiner eigenen Gefühls- und Erlebenswelt zu begleiten, ohne ihn zu korrigieren oder auf unsere »Wahrheitsebene« heben zu wollen.
Auch das psychobiografische Modell nach Böhm ( 
Kap. 6.3
) hilft, den in seinem Affekt eingeschränkten Menschen, für uns erreichbar zu machen und gezielt betreuen zu können.
Bei kognitiv wenig eingeschränkten Personen kann darauf geachtet werden, dass gemäß dem operanten Konditionieren, »positives« und erwünschtes Verhalten durch Lob und Zuwendung verstärkt, »negatives« Verhalten durch weniger Beachtung negiert und reduziert wird.
Allgemein sollten hier Angebote durchgeführt werden, die das Selbstwertgefühl und die Identität stärken und Raum geben eigene Gefühle wahrzunehmen und ausleben zu können ( 
Kap. 6
).
Читать дальше