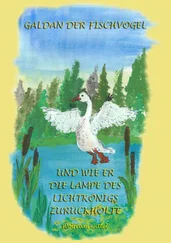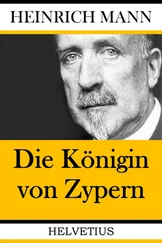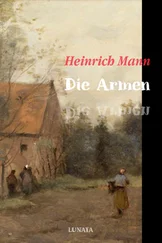Daneben gab es die Schwester der Lothringen, die berühmte Herzogin von Montpensier, deren Gatte im Heer des Königs stand; sie selbst war seine Feindin und stolz darauf, daß sie den Mörder des vorigen Königs abgerichtet hatte für die Tat. Nicht genug daran, sie wollte den Hugenotten auf dem Schafott sehen. Wie denn, am Rad und Galgen! Die Furie der Liga hetzte schon wieder von ihrem Balkon herab die Jugend der hohen Schulen, bis sie ihr Mordgeschrei durch die Straßen trugen. Die schöne, aber alternde Herzogin indessen in ihrem Palast hielt sich den unbändigen Busen. Der Haß und Rachedurst, der ihn stürmisch bewegte, war schmerzhaft, zuletzt wurde er ihr verdächtig. Der Sieg Navarras bei Ivry, sie hatte ihn durch ihren Bruder Mayenne, den Besiegten, früher erfahren als sogar die Spanier, hatte die Kenntnis lange für sich behalten und verschwieg sich selbst den Grund, bis es sie überwältigte. „Navarra“, sagte sie, um nicht „Frankreich“ zu sagen; aber in ihrer leidenschaftlichen Brust hieß sein Name nur Henri, und ihr Haß war ihr zur Qual wie sein Glück. Sie hörte, daß er den Prior ihres Mönches gefangen hatte, desselben, den sie zum Königsmord abgerichtet hatte. Henri übergab den Prior seinem Gericht in Tours, der Prior wurde von vier Pferden zerrissen, die Herzogin lag drei Stunden in Ohnmacht. Ambroise Paré kam, ein alter Chirurg, den alle achteten, obwohl er Hugenott war. Er ließ die Dame zur Ader, und als sie erwachte, fragte sie: „Ist er schon da?“ — in einem Ton, mit einem Gesicht, daß der Greis zurückwich, er, der die Bartholomäusnacht und auch sonst schon mehrmals die Hölle erblickt hatte.
Die große Stadt glaubte alles. Er ist da, glaubte sie, während er erst überlegte, ob er seine Soldaten nochmals gegen die Vorstädte von Paris losließe. Wir verhungern! weinten sie, als ihre Märkte noch hätten voll sein können; wurden aber Verraten von den Vorstehern der sechzehn Stadtteile, die nur spanisch dachten, obwohl ihre Rede französisch war. Am achten Mai des Jahres 1590 hielt der König seine Hauptstadt endlich ganz eingeschlossen. Diesmal ließ er ihr keine Ausflucht, weder links noch rechts des Flusses, nahm die Vorstädte, verhinderte Gewalt, ließ seine Geschütze mäßig über die Mauern schießen — umschloß sie nur, eng und ohne Ausflucht.
Am vierzehnten begannen die Prozessionen. Die Mönche führten die Bürgerwehr an. Noch hatten alle gegessen, die Mönche mehr als nötig; sie schnauften furchtbar unter dem Panzer, in den sie ihre Bäuche gezwängt hatten. Die Kutte war hochgeschürzt, die Kapuze zurückgeschlagen, der Mönch trug Helm und Waffen. Beim Erscheinen des päpstlichen Legaten wollten die geistlichen Krieger ihn passend begrüßen und erschossen ihm dabei seinen Almosenier. Der Herzog von Nemours sagte hier im Vertrauen zum Herzog d’Aumale: „Wie lange werden wir den Unfug mitmachen? Ich bin ein Lothringen und immer noch Franzose: hier aber ist Spanien. Wir sind auf der falschen Seite. Unser Platz wäre jenseits der Mauer, mitsamt unseren siebzehnhundert Deutschen, achthundert Mann französischem Fußvolk, sechshundert Reitern. Guise oder Navarra, das wird draußen auf ehrenvolle Art entschieden.“
D’Aumale antwortete: „Vergessen Sie nicht die Bürgerwehr und alle, die jemals Hugenotten gemetzelt haben. Vergessen Sie nicht die Furcht vor Wiedervergeltung, die den Bürgerkrieg so ausschweifend macht. Ziehen wir jetzt ab, Paris wird sich dem Rausch seiner Angst ergeben, wird sich selbst abschlachten und wird schwören, daß es für die wahre Religion sei.“
Der andere Herr reckte die Hand nach der tanzenden, brüllenden Prozession, zum Zeichen, daß er begriffen habe. „Paris will spanisch sein“, sagte Nemours. „Wir Guise sind betrogen, Don Philipp zahlt mir nicht einmal mehr den Sold. Mendoza prägt Bettelpfennige und wirft sie aus seinen Fenstern. Wozu? Da dies Volk höchstens noch Katzen ißt, und die am Sonntag?“
Die beiden Herren ritten nur mit starker Bedeckung durch die Stadt, die sie verteidigen sollten. Gewöhnlich flüchtete alles, wegen schlechten Gewissens, oder weil niemandem mehr zu trauen war. Vereinzelt ließ niemand sich leicht sehen. Die Haufen, die unterwegs waren, wollten bei ihren Unternehmungen die Stärkeren sein. Sie machten Haussuchung in den Klöstern, voran die Bürgerwehr; fanden zwar nur so viel, wie sie auf der Stelle verzehren konnten, alles andere war gut versteckt; dafür spaßten sie und drohten den Mönchen, auf einem steuerlosen Schiff würden die Fettesten zuerst gefressen. Satt wie sie endlich waren, kamen erst Messe und Predigt daran, damit niemand Mut und Eifer verlöre.
Andere Haufen umdrängten die Türme, jeder wollte hinauf, Felder und reifende Frucht von fern zu erblicken. Nachher stürmten sie erbittert vor das Parlament und schrien sich heiser nach Brot. Unter den Frauen brach der Wahnsinn aus: sie boten sich selbst an, man sollte sie niedermachen und ihr Fleisch verkaufen, wenn nur ihre Kinder Brot bekämen!
Was hätte Brisson, Präsident des hohen Gerichtes, mit diesen Armen angefangen. Er hatte selbst nichts, er war ein ehrlicher Mann. Schon hatte man auch in seinem Hause von dem verdächtigen Mehl genossen, womit Schleichhändler hinten heraufkamen, und das sie aus keiner Mühle geholt hatten, sondern des Nachts vom Friedhof. Brisson, Humanist, dem Recht ergeben, daher in seinem Herzen ein Mann des Königs, verhandelte, um diese wütende Stadt zu retten, mit Herrn de Nemours. Sie führten das gefährlichste Gespräch, das ein großer Bürger und ein großer Herr je wagen konnten unter dem eisernen Himmel des Fanatismus. Sie gestanden einander, daß der Aufstand der gottlosen Widervernunft jetzt wahrhaft sein äußerstes Ziel erreicht habe, und die Liga niederzuschlagen, so viele Opfer es irgend kosten könnte, wäre dennoch von jetzt ab der einzige Ausweg, um sowohl die menschliche Vernunft als Gott zu versöhnen.
Jedes Opfer! — sagten die beiden wohl, spähten aber unentschlossen hinter einem Vorhang aus dem geöffneten Fenster. Was sie erblickten, war die Kirche und das überquellende Portal, war die Straße voll Volk, alle stumm, alle vom Hunger bleich, vor Schwäche kniend oder in aufrechter Stellung entrückt; und zu hören war allein die Stimme des Predigers, ein Gebell. Der König wird die Messe abschaffen und alle umbringen! Volk! Dein Heil bedenke! Der Mann der Lüge, Boucher, hatte sie groß und Legion gemacht seit vielen Jahren mit seinem listigen Rasen, und begleitete die Lüge jetzt bis an ihren Rand, bis über den Abgrund; er bellte, er schnappte von der Kanzel. Die nächsten erschraken vor ihm, sie stießen rückwärts gegen die Masse, die Masse wankte, sie stöhnte in Todesfurcht und Schwäche. Man erdrückte und zertrat einander fast lautlos, nur Stöhnen, und das Gebell. Da beendeten Brisson und Nemours ihre hoffnungslose Unterredung. Waren aber natürlich belauscht worden. Mönche mitsamt einer meuchlerischen Rotte drangen ein, um das ganze Parlament aufzuhängen. Der Herzog mußte schießen lassen.
Da nach dieser Rede des bewährten Boucher gegen den König und die Vernunft seine Hörer abflossen so hungrig wie zuvor, waren es zuerst dichte Gefälle menschlicher Körper, dann langsamere Bächlein, endlich aber Nachzügler wie Rinnsale, die den Strom nicht mehr finden. Diese tropfen armselig und matt in die umliegenden Gassen. Eine Frau sinkt erschöpft gegen die Hauswand. O Hoffnung! Ihr Knabe hat eine Ratte entdeckt im Kanal, der bald offen, bald verdeckt, inmitten der Gasse läuft. Der Knabe steigt hinein, kriecht unter den Steinen durch, windet sich aus dem Loch und hält die Ratte. „Mutter! Essen!“ In diesem Augenblick kommen zwei Landsknechte einher, ein Ungetüm von einem Landsknecht und ein Kleiner mit Spürnase. Dieser faßt den Knaben ab, er will ihm die Ratte nehmen, der Knabe schreit und läßt sie nicht los. Da hebt der große Landsknecht ihn selbst vom Boden auf, faßt ihn hinten am Kittel und hält das Kind an seiner Tatze vor sich hin wie einen Einkauf — stapft gewaltig und biegt um die Ecke. Sein bleicher Freund schielt, ein Auge eingedrückt, nochmals zurück, dann sind sie fort.
Читать дальше