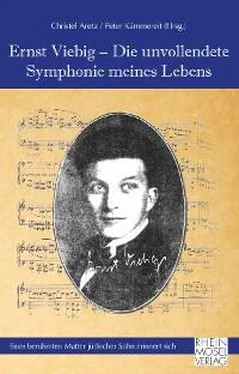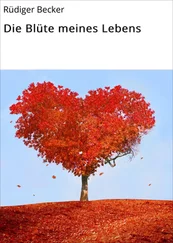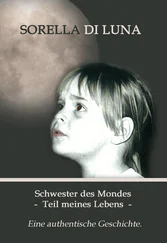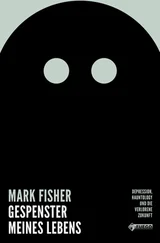Großvater Cohn hatte mit Anna Cohn, geb. Redlich, noch einen Sohn gezeugt: meinen Onkel Franz, der sich schon frühzeitig in Colmers umtaufen ließ und eine große Chirurgenkarriere machte, Geheimrat und Leibarzt verschiedener gekrönter Häupter wurde, um sich schließlich als einstmaliges Mitglied des Preußischen Herren-Clubs, die Brust bestückt mit den Orden und Verdienstkreuzen vieler Länder, 1933 nach den USA abzusetzen, wo er in der Park Avenue eine Praxis eröffnete. Er dürfte heute längst ins Emigranten-Walhall abberufen sein.
Meine Kindheit war bevölkert von den großen Namen jener Zeit, in der die »Junge Freie Volksbühne« die führende Avantgarde der Literatur und des Theaters war: Gerhart Hauptmann, Herbert Eulenberg, Cäsar Flaischlen, Georg von Ompteda (der großartige Maupassant-Übersetzer), Fedor von Zobeltitz, Max Osborn, Richard Huch, Börries von Münchhausen, Ina Seidel, Georg Hermann, Heinrich Zille und noch viele andere waren der Freundeskreis meiner Eltern. Das Haus meiner Eltern war eines der am meisten der Literatur verhafteten in Berlin, zumal meine Mutter damals zu den ganz großen Hoffnungen und Erfüllungen der deutschen Roman-Literatur gehörte.
Mutter war, wenn auch ganz anders als Vater, ebenfalls bürgerlicher Herkunft. Für beide Teile bedeutete ihre Heirat zunächst eine Mesalliance, da die Familien der beiden Liebenden aus religiösen, nicht rassischen Gründen dagegen waren und es harte Kämpfe gab. Da aber meine Mutter bereits sechsunddreißig und mein Vater zweiunddreißig Jahre alt waren, so halfen alle Widersetzlichkeiten der Familien nichts, zumal mein Vater freudig gerade und überzeugt zum evangelischen Glauben konvertierte. Und es muss zum Lob meiner Großmutter und aller Familienangehörigen mütterlicherseits gesagt werden, dass – so lange ich denken kann – niemals auch nur der Schimmer einer antisemitischen Einstellung bei ihnen zu finden war, und dass mein Vater seiner Schwiegermutter ein rührend guter Sohn war und die Zuneigung der alten Dame, die mit zweiundachtzig Jahren starb (ich erinnere mich sehr gut an sie) bis zuletzt besaß. Nicht ganz so auf Seiten der Familie meines Vaters. Meine Mutter fühlte sich stets als Eindringling, und nur die Tatsache ihres berühmten Schriftstellernamens ließ die Verwandtschaft schweigen.
Meine Mutter ist in der Stadt Trier im Schatten der Porta Nigra geboren als letztes von drei Kindern des Oberregierungsrates Ernst Viebig und der Clara Langner. Von ihren Geschwistern kannte sie nur ihren achtzehn Jahre älteren Bruder Ferdinand, der trotz seines dringenden Wunsches, Kapellmeister zu werden, die Staatsbeamtenkarriere einschlagen musste und schließlich Oberstaatsanwalt der Provinz Hessen wurde. Er war verheiratet mit Henriette Göring, einer Tante des nachmalig unrühmlichst bekannten Reichsmarschalls Hermann Göring, wobei gleich gesagt sein soll, dass diese großartige Frau, die später eine bedeutende Rolle in dem protestantischen Orden der Herrnhuter spielte, niemals irgendwelche Neigung für den Nazismus zeigte. Immerhin zeigt durch sie mein Familienbild die Groteske auf, dass ich auf diese Weise durch Tante Henriette ein Schwippvetter des Reichsjägermeisters wurde: meine Tante, seine Tante! Der älteste Bruder meiner Mutter, ebenfalls Ernst heißend, war ein belastetes unglückliches Kind. Er war Epileptiker und starb glücklicher Weise als junger Mann im Hause des schwäbischen Pfarrers Holzbaur, dessen eine Tochter später im Hause meiner Eltern eine wichtige Rolle spielen sollte.
Alle diese Beziehungen beweisen die starke Bindung der Viebigschen Familie zum Protestantismus. Die Mutter meiner Mutter war eine enge Freundin des Pastors von Bodelschwingh, des Begründers der Stiftung für Epileptiker »Bethel«. Nun meine Mutter im erzkatholischen Trier und später, als der Großvater stellvertretender Regierungspräsident in Düsseldorf wurde, dort aufwuchs, erklärt sich die Stärke ihres protestantischen Glaubens dadurch, dass sie, als profunde Kennerin katholischen Dogmas und katholischer Bräuche, niemals daran dachte, zum Katholizismus zu konvertieren, sondern lebenslang durch ihr schriftstellerisches Werk in dichterischer Form Kritik am Katholizismus übte. Großvater Viebig und Großmutter Langner stammten aus dem Osten, der Provinz Posen. Meine Mutter lernte schon als junges Mädchen, zu Besuch bei ihrem (ich glaube) Patenonkel Matthieu im katholischen Trier, welcher dort Untersuchungsrichter war, die Eifel und, durch Besuche bei ihren Verwandten in der preußischen Provinz Posen, das östliche Deutschland – wieder stark katholisch – kennen und die Versuche des Preußentums, die polnische Irredenta aufzusaugen. Die Polenfrage, die damals die Gemüter der preußischen Intelligenz und des Junkertums bewegte, fand seinen Niederschlag in Mutters Roman »Das schlafende Heer«, in welchem sie das Wiedererwachen Polens seherisch voraussagte. Diese Art Gegensätze des Osten und des Westens und der Glaubensbekenntnisse haben aus meiner Mutter eine begeisterte Preußin gemacht, zumal sie als Kind die Preußisierung des Rheinlandes und die Einigung des Reiches unter der Kaiserkrone 1871 (sie war damals elf Jahre alt) bereits bewusst miterlebte. Ihr Roman »Die Wacht am Rhein« ist der – allerdings liebenswürdigere – Gegensatz zum schlafenden Heer. Berühmt wurde meine Mutter allerdings schon durch eines ihrer ersten Bücher, »Das Weiberdorf«. Und ich werde noch, ohne die Absicht, mich biografisch oder literarisch in das Lebenswerk meiner Mutter zu vertiefen, im Verlauf meiner eigenen Lebensgeschichte gelegentlich auf dieses und jenes Werk ihrer Feder zurückkommen.
Wichtig ist für mein Leben, dass meine Eltern spät heirateten. Ich wurde geboren, als meine Mutter bereits siebenunddreißig und mein Vater dreiunddreißig Jahre alt waren, und ich blieb das einzige Kind dieser relativ alten Eltern. Die Erinnerung meiner Kindheit kennt eine überaus schöne Frau, hochgewachsen und etwas heroisch, und einen zierlich gewachsenen, geistvollen und witzigen Vater, der ein etwas ungeduldiges und heftiges Temperament hatte. Die Eltern lernten sich dadurch kennen, dass die junge Clara Viebig zu dem Verleger Fritz Th. Cohn, Sozius des Fontane-Verlages, kam, nachdem sie mit ihrer Mutter nach Großvaters Tod nach Berlin verzogen war, um an der Hochschule für Musik Gesang zu studieren, aber nebenbei zu schreiben begann und damals die Erstlinge ihres Schriftstellertalentes meinem Vater zur Beurteilung vorlegte. Es mag wohl 1895 gewesen sein, als beide sich zuerst trafen. Aus Erzählungen meiner Mutter weiß ich das erste Urteil meines Vaters über das, was sie ihm vorlegte. Er sagte: »Mein liebes Kind – das ist schlecht – aber sie haben Talent.« Und nun begann der Verleger die junge Autorin zu leiten, ihr Rat und Erklärungen zu geben. Das geistige Band wurde geschlossen, dem das einer tiefen Liebe bald folgte. Bis an das Ende seiner Tage hat meine Mutter in ihrem Mann den besten Kritiker gefunden, der sie beraten hat.
Als Kind und Knabe führte ich den Doppelnamen Cohn-Viebig, bis mein Vater die Löschung des Namens »Cohn« durch kaiserliche Kabinettsorder für mich erwirkte und ich seitdem den Namen »Viebig« legaliter allein führe.
Ich kehre zurück zu meiner Kindheit nach dieser notwendigen flüchtigen Abschweifung ins Familiengeschichtliche.
Eine dunkle Erinnerung, wahrscheinlich unterstützt durch Erzählungen meiner Mutter, die später manchmal sagte: »Ernst war ein so liebes Kind«, führt mich in jenes Kinderzimmer gleich rechts neben der Vordertür jener Wohnung, von der ich schon sprach: ein Zimmer, dessen Fenster nach einem halbdunklen Hof hinausging. Ich sehe mich in einem Stühlchen sitzen, in dessen Sitz ein Töpfchen eingelassen war und vor welchem ein Spieltisch das Kind am Herausfallen hinderte. Dieser Tisch hatte rechts und links zwei Reihen bunter Kugeln auf ein Drahtgestell aufgereiht und in der Mitte ein Bild mit vielen Tieren in grellen Farben. Ich sehe mich stundenlang eingepfercht in dieses Stuhltischchen – ganz allein. Und dieses Alleinsein ist mir als wesentlich in Erinnerung geblieben. Ich hatte keine Geschwister, keine Gespielen als Kleinkind, nur das Mädchen Ida (war es die, deren Bräutigam der Feldwebel war, oder eine andere – ich weiß es nicht mehr). Meine Mutter arbeitete, war in der ersten Periode ihres schriftstellerischen Aufstieges. Zwei große Romane, Novellen und anderes waren die »Jahresproduktion«. Sie schrieb alles mit der Hand, erst ins »Unreine« und dann nochmals in »Reinschrift«, diabolische Qual der Arbeit in einer Zeit, da es die Schreibmaschine noch nicht gab. Als sie mit mir im siebenten oder achten Monat schwanger ging, wurde in Frankfurt am Main ihr Einakterzyklus »Der Kampf um den Mann« (in naturalistischem Ibsen- und Hauptmannstil, befruchtet von ihrem Meister Zola) uraufgeführt, ein Stück, in welchem der später so berühmte Victor Barnowsky debütierte und dank seiner und meiner Mutter mäßigen Leistung einen Theaterskandal verursachte. Mutter behauptete stets, dass meine Tendenz zum Dramatischen im Leben und Schaffen jenem Theaterskandal zu verdanken sei. Ihre unglückliche Liebe war das Theater. Da ihr der Theatererfolg nicht beschieden war, trotz der großen Rosa Bertens, die mit der »Bäuerin« triumphale Tourneen durch Deutschland machte, haben Mutter und Sohn, ohne Zweifel, diese Theaterinstinkte weitestgehend ins praktische Leben verdrängt. Erst späte Reife sollte das ändern.
Читать дальше