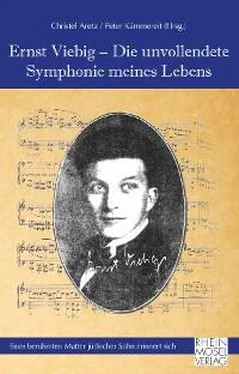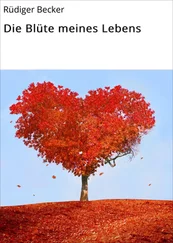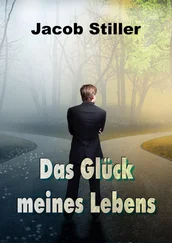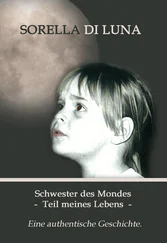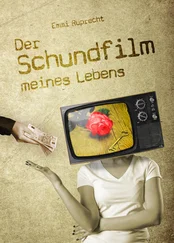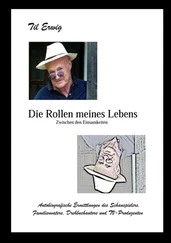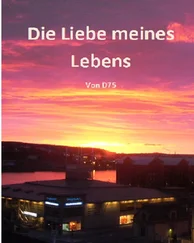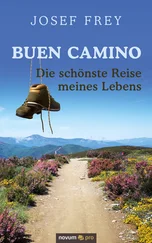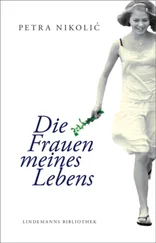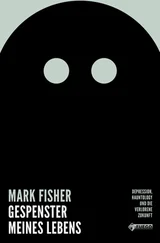Man kann in Ernst Viebigs lebenslangem bodenlosen Leichtsinn die ›hamartia‹, das Selbstverschulden des Helden sehen, dessen exzessive Bestrafung nach Aristoteles die Tragik ausmacht. Die Katastrophe, in die sein Leben letztlich mündet, hat sich aber nicht Ernst Viebig zuzuschreiben, sondern das deutsche Volk, das in seiner Mehrheit einem absurden Rassenwahn anhing, dem erst Lebensläufe und dann unzählige Leben zum Opfer fielen.
Die unvollendete Symphonie meines Lebens
Das Jahr 1897 hat für den Deutschen, ja für den Zentral-Europäer, eine weit mehr charakteristische Bedeutung, als das gebräuchliche Wort »fin de siècle« einschließt. Es stellt den Zenith der sogenannten »wilhelminischen Epoche« dar, eine Zeit höchster bürgerlicher Saturiertheit, wirtschaftlich allerorten blühend oder die Früchte tragend, die gewonnene Kriege damals noch zur Reife bringen konnten. Das »Deutschland über alles« hatte damals weniger imperialistischen Sinn, den man diesem Lied später unterschob, sondern spiegelte den Stolz einer geeinten Nation, welche sich dank ihrer in voller Blüte sich entfaltenden Industrie und Wissenschaft mitführend unter den Völkerfamilien nennen durfte. Und niemand ahnte, dass die Kaiserhymne, deren Melodie bezeichnenderweise die gleiche der englischen Nationalhymne war, durch das Byzantinische ihrer Textierung keine zwanzig Jahre später nicht nur die Nation, sondern eine ganze Welt dank einer progressiven Megalomanie in das blutige Geschehen des I. Weltkrieges führen sollte, in die Zeit der sozialen Probleme, der Revolutionen, neuer Kriege und einer neuen Völkerwanderung mit allen Erscheinungsformen, die die erste Hälfte des XX. Jahrhunderts kennzeichnen.
Ich – am 10. Oktober 1897 in Berlin geboren – erinnere mich sehr wohl des Zeitbildes meiner frühen Kindheit, aus der sich das erste Telefon, das Automobil, die Entwicklung des Überseetelegramms, die immer schneller und größer gebauten Luxusschiffe, der Übergang von der Gasbeleuchtung zum elektrischen Licht (die ersten Nernst-Lampen), die Erfindung der Röntgenstrahlen, der schmerzlosen Zahnbehandlung, die Erfindung des Fahrrades mit zwei gleichgroßen Rädern und seines Vorgängers, des Velozipeds, das ein riesengroßes und ein kleines Rad hatte, wobei der Fahrer hoch über dem Boden als eine Art Akrobat das Gleichgewicht halten musste, und noch manch andre Dinge abheben.
Ich erinnere mich noch gut der Pferdebahnen, der schnaufenden Eisenbahnlokomotiven mit trichterförmigen Schornsteinen, der in Berlin auftauchenden Hochbahn und später »Untergrundbahn«, der Schwebebahn in Elberfeld-Barmen, der die Straßen füllenden Droschken und Pferdefuhrwerke, insbesondere des »Coupés« unseres Hausarztes, des Dr. – alias Sanitätsrats – Dr. Altmann, mit dem er seine Krankenbesuche absolvierte, erinnere mich an die hochrädrigen Kinderwagen im Schöneberger Stadtpark, von hochbusigen Ammen in der malerischen Tracht ihrer Heimat, des Spreewaldes, geschoben, habe vor Augen das prunkvolle Bild militärischer Paraden, sehe die blauen Polizisten mit Pickelhaubenwarzenhelm, mit ihren Einheitsschnurrbärten, deren Mode der des »allerhöchsten Landesherren« nachgeäfft war, deren Pflege eine Männerwissenschaft und deren beim Kuss kitzelnde Endspitzen das Entzücken der Damenwelt waren; erinnere mich der mannigfaltigen Formen von Vollbärten, vom gewöhnlichen »Fuß-Sack« über den »Kaiser Franz Josephs-Bart« bis zum »Henri IV«, der elegantesten Form des Bärtigen, der Wespentaillen festkorsettierter Damen, ihrer weit fallenden, fast den Boden berührenden Röcke, ihrer nahezu wagenradgroßen Hüte oder der jugendlichen »Florentiner«, weiche Strohhüte mit Schleifen oder künstlichen Blumen überreich garniert, mit langen Hutnadeln im Haar festgehalten, der üppigen Frisuren, unterstützt durch »Unterlagen« oder den »Willem«, wie der Berliner den künstlichen Zopf nannte, und – abseits solcher Umwelt – meines Elternhauses sehr wohl.
Bis zu meinem achten oder neunten Lebensjahr wohnten wir in Berlin selbst, im Stadtteil von Schöneberg, gegenüber dem Botanischen Garten, in einem jener monströsen Mietshäuser aus der »Gründerzeit [1] [ 1 ] Anm.: Elssholzstraße 13 II vgl. Irene Fritsch: »Wo Clara Viebig in Berlin wohnte …« in Clara Viebig - Ein langes Leben für die Literatur, Zell/Mosel 2010, S. 125f [ 2 ] Anm.: Berlin-Schöneberg, Belzigerstr. 48/52. Vgl. Pharus-Plan Berlin, Berlin 1902
«, überladen mit Stuck und Türmchen, verschnörkelten Gittertüren, einem »Eingang für Herrschaften«, wo sich am Eisenportal eine große Messingschale befand, in der ein Glockenzug angebracht war, während der »Eingang für Dienstboten und Lieferanten« durch den Hof ging. In diesem vier- oder fünfstöckigen Gebäude, dessen erster Stock die »Beletage« genannt wurde, gab es einen Fahrstuhl, damals »Lift« genannt, eine Art von Vogelkäfig, der noch nicht durch Elektrizität betrieben wurde, sondern durch den Portier mittels eines Strickes in Bewegung gesetzt wurde, dessen Gegengewicht nach primitiven mechanischen Gesetzen das Vehikel nach oben oder unten trieb. Dieses Beförderungsmittel ist mir deshalb lebendig in Erinnerung, weil ich, wenn ich etwas ausgefressen oder später in der Schule schlecht abgeschnitten hatte, mich nachhause kommend des Fahrstuhls bediente und durch die »Vordertür« (aus reichverziertem Eichenholz gedrechselt) die Wohnung betrat, während ich, wenn alles gut war, die »Hintertreppe« benützte. Die Gründe für dieses Vorgehen sind mir allerdings weder bekannt noch erklärlich. Ich weiß aber mit Bestimmtheit, dass es so war, denn die Geographie dieser Wohnung ist mir noch immer sehr gut im Gedächtnis.
Sie unterschied sich wahrscheinlich kaum von anderen »hochherrschaftlichen« Behausungen Berlins. Kam ich durch die Vordertür, fand ich mich in einem ziemlich großen Vestibül, in welchem einige Stühle, ein Tischchen mit einer Zinnschale voller Visitenkarten, ein Schirm- und Kleiderständer und vielleicht noch anderes standen, alles im sogenannten »altdeutschen« Stil. Diese Möbel waren mehr oder weniger reich geschnitzt und mit Blechknöpfen anmutig beschlagen, die Stühle wiesen in der Rückenlehne eine herzförmige Aussparung auf und waren aus schwerem Eichenholz. Es scheint, dass diese ein Teil des »Herrenzimmers« meines Vaters waren, denn mir sind lebhaft der Schreibtisch und ein Rauch- und Likörschränkchen meines Vaters in Erinnerung, die den gleichen Stil aufwiesen, ebenso wie das große Bücherspind mit Glasscheiben, die von innen durch grüne Seidengardinen gegen neugierige Blicke geschützt waren.
Rechts neben dem Eingang lag mein Kinderzimmer, an dessen Aussehen ich nicht mehr die geringste Erinnerung habe. Dagegen weiß ich noch, dass neben dem »Herrenzimmer« auf der einen Seite das Arbeitszimmer meiner Mutter lag, möbliert mit dunkelgrün gebeizten Möbeln im damals so modernen »Jugendstil«, ein Stil, der – glaube ich – von der halbintellektuellen, halbmondänen illustrierten Zeitschrift »Die Jugend« kreiert wurde, eine Zeitschrift, die viele Maler, speziell den mondänen Reznicek berühmt gemacht hatte, dessen gewagte erotisierende Halbnacktheiten sich mit den ersten erotischen Eindrücken meiner Kindheit vermischen. Was dieses Zimmer enthielt, kann ich nicht mehr sagen, denn ich weiß, dass ich es selten betreten durfte.
Auf der anderen Seite führte eine Schiebetür ins Speisezimmer, die zur Hälfte mit geschliffenen Milchglasscheiben ausgerüstet war, da das typische »Berliner Zimmer« (das Esszimmer) stets etwas dunkel war, weil es nur ein einziges Fenster zum Hof des Hinterhauses hatte. Während im Vestibül eine Lampe hing, deren vielfarbige Butzenscheiben keine Helle, sondern nur Halbdunkel verbreiteten, hing über dem großen und schweren Esstisch, der, wenn nicht gegessen wurde, mit einem Teppich in ausgezeichneter Perser-Imitation bedeckt war, ein »Kronleuchter« mit vielen stehenden Flammen und einem grünen Seidenschirm, der die Petroleumlampe und dann später die Gasflamme kunstvoll verbarg. An den Wänden gab es viele »Bauernteller« aus bemaltem Ton oder Porzellan, und auf dem Buffet, einem Monstrum an Größe, mit vielen Aufsätzen, Nischen und Säulen und, als Clou, eine Art Grotte mit einem großen hängenden Delphin aus Zinn, aus dessen Maul Wasser laufen konnte (falls man es durch den Schwanz des Fisches eingefüllt hatte), mit einem Muschelbecken darunter zum Händewaschen, standen eine Menge von großen, mittleren und kleinen Zinntellern auf Drahtständern, wie auch Krüge aus dem gleichen Metall und aus Kupfer, wobei mir ein Literkrug, mit sinnigen Bildern aus der deutschen Sage in Hochrelief verziert, besonders lebhaft in Erinnerung ist, weil sein dicker ziselierter Zinndeckel einen hockenden Zwerg darstellte.
Читать дальше