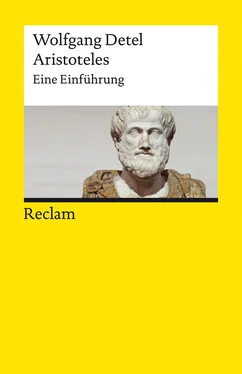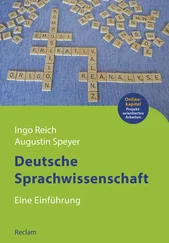(a) schwer a aus Bronze bestehen
(b) aus Bronze bestehen aStatuen aus Metall
(c) schwer aStatuen aus Metall
(ii)* Der Mond ist zur Zeit t verfinstert, weil (a) immer wenn ein Stern am Himmel im Sonnenschatten der Erde liegt, verfinstert ist und (b) der Mond zur Zeit t im Sonnenschatten der Erde liegt (Prämisse (b) verweist auf eine effiziente Ursache); syllogistische Notation:
(a) verfinstert a im Sonnenschatten der Erde sein
(b) im Sonnenschatten der Erde sein bMond zur Zeit t
(c) verfinstert bMond zur Zeit t
(iii)* Die Verdauung erfordert Spaziergänge nach dem Essen usw. (usw. steht für: vergleichbare Empfehlungen der Mediziner zur Förderung der Verdauung), weil (a) die Erhaltung der Gesundheit Spaziergänge nach dem Essen usw. erfordert und (b) die Erhaltung der Gesundheit das Ziel der Verdauung des Essens ist (Prämisse (b) verweist auf eine finale Ursache); syllogistische Notation:
(a) Spaziergänge nach dem Essen usw. a Erhaltung der Gesundheit
[37](b) Erhaltung der Gesundheit aVerdauung des Essens
(c) Spaziergänge nach dem Essen usw. aVerdauung des Essens
(iv)* Eine Saite S produziert Töne in einer Oktave, weil (a) die Produktion von Tönen in einer Oktave die Teilung der Saite im Verhältnis 1 : 2 erfordert und (b) die Saite S im Verhältnis 1 : 2 geteilt wurde (Prämisse (b) verweist auf eine formale Ursache); syllogistische Notation:
(a) Produktion von Tönen in einer Oktave a Teilung im Verhältnis 1:2
(b) Teilung im Verhältnis 1:2 bSaite S
(c) Produktion von Tönen in einer Oktave bSaite S
In allen diesen Beispielen ist (i) der Schluss von den Prämissen (a) und (b) auf die Konklusion (c) ein logisch gültiger Syllogismus, (ii) der kursiv geschriebene Begriff der Mittelbegriff, und (iii) Prämisse (b) die Prämisse, die auf eine aristotelische Ursache verweist (mit dem Mittelbegriff als erklärender Eigenschaft). Im Übrigen erklären die Demonstrationen (i)* und (iii)* universelle Fakten, die Demonstrationen (ii)* und (iv)* dagegen singuläre Fakten.
Damit hatte Aristoteles das Konzept der deduktiven wissenschaftlichen Erklärung erfunden.
Wir können nun den letzten Schritt im Aufbau einer wissenschaftlichen Theorie, wie Aristoteles sich ihn vorstellt, leicht beschreiben: Unter allen Deduktionen, die in einer vollständigen Analyse auftauchen, müssen diejenigen ausgewählt werden, die zugleich Demonstrationen und damit deduktive wissenschaftliche Erklärungen sind – deren zweite Prämisse sich folglich als eine der aristotelischen Ursachen klassifizieren lässt.
[38]Aristoteles bemerkt des Öfteren, dass die Einsicht in die obersten Prinzipien oder Definitionen das höchste Ziel wissenschaftlicher Aktivität ist und dass sich die obersten Prinzipien oder Definitionen nicht selbst noch einmal demonstrieren lassen (APo. I 2; II 19). Wir dürfen diese logisch triviale Bemerkung nicht missverstehen – so als wollte er sagen, dass wir die obersten Prinzipien und Definitionen direkt und unmittelbar, also ohne weitere rationale Begründung, erfassen könnten. Ganz im Gegenteil können wir sie nach Aristoteles nur am Ende eines zum Teil langen Begründungsganges erkennen.
Allerdings unterscheidet er verschiedene Arten von Prinzipien (APo. 1 2). Die wichtigste Art sind die obersten erklärungskräftigen Prämissen, die an der Spitze einer ausgearbeiteten wissenschaftlichen Theorie stehen. Einige dieser Prinzipien nennt Aristoteles auch Definitionen , und zwar jene, die syllogistisch konvertieren und somit wahre syllogistische Sätze der Form AaB sind, für die auch die Umkehrung BaA wahr ist. Natürlich handelt es sich dabei nicht um Definitionen im modernen Sinne – also nicht um bloße analytische Sätze oder Analysen von Wortbedeutungen, sondern um empirisch oder mathematisch gehaltvolle Sätze über die Welt. Prinzipien dieser Art können trivialerweise nicht selbst demonstriert werden, d. h., sie könnten nicht innerhalb der Theorienkonstruktion deduktiv erklärt werden. Aber ein Erfassen dieser Prinzipien setzt ersichtlich die Konstruktion einer abgeschlossenen Theorie voraus; erst nach der Theorienkonstruktion können wir erkennen, welche universellen Sätze in ihrem Gegenstandsbereich Definitionen sind. Daher sind genau diejenigen vielfältigen Gründe, die für die Konstruktion und [39]Annahme einer Theorie im Ganzen sprechen, auch die Gründe, die dem Postulat ihrer Definitionen zugrunde liegen. In diesem Sinne ist das Erfassen dieser Art von Definitionen nicht unbegründet. Aristoteles bemerkt ausdrücklich, dass die Angabe oberster Definitionen und oberster erklärungskräftiger konvertierbarer Prämissen in Analysen auf dasselbe hinausläuft (APo. II 10).
Wenn wir eine wissenschaftliche Theorie konstruieren, müssen wir nach Aristoteles auch davon ausgehen können, dass die fundamentalen Gegenstände, die mithilfe der Theorie untersucht werden sollen, tatsächlich existieren: etwa das Heiße und Kalte in der Physik, die natürlichen Arten von Tieren in der Biologie oder Kreis und Gerade in der Geometrie (APo. I 10). Prinzipien dieser Art heißen Hypothesen . Im Einzelfall sind auch die Hypothesen begründungsbedürftig – als Existenzannahmen naheliegenderweise im Rahmen der ersten Philosophie oder Ontologie. Beispielsweise ist es Aufgabe der Ontologie zu zeigen, ob und in welchem Sinne fundamentale geometrische Gegenstände oder lebende Organismen existieren (Metaph. XIII).
Und schließlich benutzen wir zum Aufbau einer Theorie logische Regeln, gelegentlich auch mathematische Formeln. Diese Voraussetzungen sind im Gegensatz zu Definitionen und Hypothesen nicht spezifisch für bestimmte Wissenschaften oder Theorien, sondern kommen gleichermaßen in allen Wissenschaften vor. Prinzipien dieser dritten Art nennt Aristoteles Postulate (griechisch Axiome ). Ihre Begründung erfolgt im Rahmen der formalen Logik und Mathematik.
Von allen drei Prinzipienarten lässt sich also sagen, dass sie zwar nicht demonstrierbar und in diesem strengen [40]Sinne nicht erklärbar sind, dass sie aber in einem weniger strengen Sinne nicht nur begründbar, sondern sogar begründungsbedürftig sind. Von einem unmittelbaren Erfassen der Prinzipien kann im Rahmen der aristotelischen Wissenschaftstheorie nicht die Rede sein.
Aristoteles war zweifellos davon überzeugt, dass es selbst für endliche menschliche Wesen prinzipiell möglich ist, die Wahrheit und oberste Prinzipien zu erfassen; in diesem Sinne war er kein Skeptiker. Zugleich betont er jedoch, dass es schwierig ist zu wissen, ob wir etwas wirklich wissen (APo. I 9). Tatsächlich vertritt er die Auffassung, dass endliche menschliche Wesen in ihrem ehrlichen Bemühen um Wissen in der Regel einer Reihe von Irrtümern ausgesetzt sind und nie endgültig sicher sein können, die Wahrheit ein für alle Mal erfasst zu haben. Im einfachsten Fall können wir induktiv etablierte universelle Sätze der Form AaB nur so lange für wahr halten, wie wir empirisch kein B-Ding entdecken, das nicht A ist. Und wenn wir behaupten, dass eine universelle Prämisse der Form AaB unvermittelt, d. h. nicht weiter deduzierbar oder demonstrierbar ist, dann können wir diese Behauptung nur so lange aufrechterhalten, wie wir empirisch keine Eigenschaft C entdecken derart, dass die universellen Sätze AaC und CaB wahr sind. Sofern wir also nicht allwissend sind und einige Fakten im Kosmos noch nicht kennen – und davon ging Aristoteles mit Sicherheit aus (APo. I 12, 78a) –, können wir nicht ausschließen, dass sich unsere bislang empirisch gut gestützte Behauptung, universelle Sätze seien wahr oder unvermittelt, aufgrund der Entdeckung weiterer Fakten am Ende noch als falsch erweist.
Читать дальше