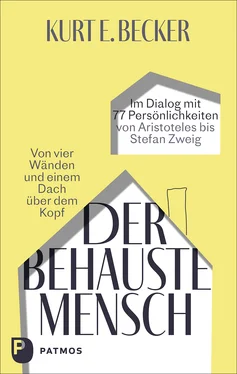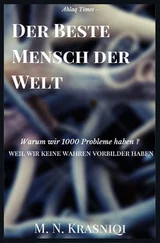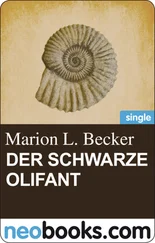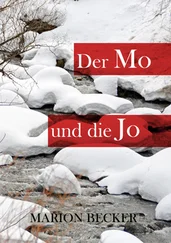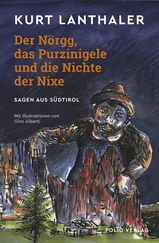Wie bei Hempels unterm Sofa
Einleitung
Zeige mir, wie du haust, und ich sage dir, wer du bist. Unser Haus, unsere Behausung, unsere Wohnung sind Ausdruck unserer Persönlichkeit; zugleich verweisen sie auf das So-und-nicht-anders-Sein unserer individuellen wie unserer kollektiven Existenz auf diesem Planeten. Wer sesshaft ist, vier Mauern um sich hat und ein Dach über dem Kopf sein Eigen nennt, lebt anders als ein Nomade oder ein Flüchtling. Und selbstverständlich hat das Behaust- wie das Unbehaustsein auch eine ethische wie eine spirituell-religiöse Dimension, die es immer mitzubedenken gilt.
Am Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu wollen seine neuen Jünger ihn kennenlernen, und sie fragen ihn: »Wo wohnst du?« Seine Antwort: »Kommt und seht.« Er lädt sie zu sich nach Hause ein. Dieses »Zuhause« Jesu verweist auf eine umgreifend religiöse Dimension unseres Lebens. Das Haus ist Bild des Himmels und Bild der Erde. Jesus sagt: »Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, und ich gehe, euch eine Wohnung zu bereiten.« Die Umwelt- und Gerechtigkeitsenzyklika »Laudato si’« von Papst Franziskus trägt den Untertitel »Über die Sorge für das gemeinsame Haus« – und dieses gemeinsame Haus ist nichts anderes als unser blauer Planet.
Wohngeschichte ist Kulturgeschichte
Wer eine Wohnung hat, kann Gastgeber sein und sich großzügig zeigen; Obdachlosigkeit grenzt aus und isoliert. Wohngeschichte ist Kulturgeschichte; der Wohnraum ist Resonanzraum des Lebens, eine erweiterte Leiblichkeit des Menschen. Die Wohnung gehört zur Intimsphäre, ist Teil der Persönlichkeit; deshalb ist sie unverletzlich, und die Polizei braucht einen richterlichen Beschluss, wenn sie Einlass begehrt. Wenn man jemanden wirklich treffen und auslöschen will, zerstört man sein Haus.
Als Behauste sind wir privilegiert im Vergleich zu den Unbehausten. Aber wir sind auch verantwortlich für unser Haus, haben Sorge dafür zu tragen, dass es erhalten und nachhaltig bewohnbar bleibt. Wenn es bei uns zu Hause beständig aussieht »wie bei Hempels unterm Sofa«, legen wir sichtbar Zeugnis von einer besonderen Art und Weise unseres Hausens ab. Die heute gängige abwertende Verwendung dieses Begriffs (etwa für »sich wüst aufführen«, hausen »wie die Vandalen«) gewinnt substantiell vor allem dort an Gewicht, wo es eben tatsächlich aussieht »wie bei Hempels unterm Sofa« oder wo die Rede ist von Gefährdungen unserer Welt, die durch rücksichtslose Menschen verursacht werden. Und es gibt viele Hempels in dieser menschlichen Welt. Und viele Sofas.
Der Begriff »hausen«, wie er in diesem Buch verwendet wird, knüpft hingegen an die ursprüngliche Bedeutung an und meint »wohnen, wirtschaften, haushalten«, mehr noch: das menschliche Sein auf Erden schlechthin – im Sinne des Existenzphilosophen Martin Heidegger, wie er nicht zuletzt im Begriff Heimat zum Ausdruck kommt. Ähnlich im Griechischen: Oikos ist das Haus im wörtlichen wie im übertragenen Sinn, oikein heißt wohnen. Hausen ist also ein Zu-Hause-Sein, im eigenen Anwesen sein; verwandt, aber aus anderer Perspektive gedacht, ist das englische to house: beherbergen, Raum geben (und dadurch ermöglichen).
Die in diesem Buch versammelten fiktiven Gespräche mit Persönlichkeiten der europäischen und der anglo-amerikanischen Geistesgeschichte bewegen sich im weitgefassten Umfeld von Architektur, Städtebau, Stadtplanung, Ökonomie, Ökologie, Bau- und Immobilienwirtschaft. Sie beziehen philosophische, sozialwissenschaftliche und psychologische Fragestellungen mit ein, immer auch im Blick auf ganz persönliche Schicksale, Erfahrungen und Anekdoten, wie sie sich zum Beispiel aus den Lebenserinnerungen meiner »Gesprächspartner« erschließen. Das »Behaustsein« erweist sich als ein in den unterschiedlichen Epochen der Geschichte bis hinein in unsere Tage so und nicht anders gewordenes Sein – des individuellen Menschen einerseits, der gesamten Spezies andererseits. Selbst die Texte des Gestern und des Vorgestern lassen immer wieder auch unsere aktuellen Fragestellungen durchscheinen und offerieren Antworten auf die großen Fragen unserer Gegenwart.
In der fortgeschrittenen Industriegesellschaft ist der Wechsel der Arbeit nicht selten auch mit einem Wechsel des Wohnortes verbunden. Vom mehr oder minder freiwillig Umziehenden, dessen Umzug bedingt ist durch den Wechsel der Arbeitsstelle, zu unterscheiden ist der Flüchtling, der aus seiner Behausung – aus welchen Gründen auch immer, Kriege oder Naturkatastrophen etwa – gewaltsam Vertriebene, der sich an einem anderen Ort, meist sogar in einem anderen Land, ein neues Zuhause suchen muss. Fraglos hat der Begriff »Flüchtling« viele Facetten und ist konnotiert mit Verlust von Heimat, von Sicherheit und von Identität. Geflohene sind Entwurzelte. Die große Mehrheit der Menschen indes in unserer so und nicht anders gewordenen Gegenwart, zumindest in unserer Hemisphäre, ist in einer bestimmten Gegend verwurzelt, auf Dauer sesshaft; das Behaustsein erweist sich als Definiens zivilisierten menschlichen Lebens. Und das über die Zeiten hinweg – von den ummauerten Städten als identitätstiftenden Behausungsentitäten über Burgen und Festungen bis hin zum afrikanischen Kral, um nur einige Beispiele zu nennen.
Diese Definition schließt den Zustand des »Unbehaustseins«, wie Hans Egon Holthusen ihn beschrieben hat, ein. Der »unbehauste Mensch« in Holthusens Sinne ist ein Sonderfall des Behaustseins und beschreibt im Konkreten das Lebensgefühl der Trümmergeneration nach dem Zweiten Weltkrieg, die mit ihren Behausungen auch ihre Heimat verloren hatte, in Ruinen leben und aus den Ruinen ein neues Behaustsein schaffen musste. Unbehaust lebt freilich auch der Obdachlose in einem Zustand des Mangels an einem Dach über dem Kopf, aber durchaus an einem ihm angestammten Platz, der auch verteidigt wird – entweder vorübergehend oder auf Dauer. Aber auch »mobile« soziale Gruppierungen, wie wir sie etwa bei den Nomadenvölkern oder in der US-amerikanischen Wohnwagenkultur finden, gehören in die Kategorie des »Unbehaustseins« ohne spezifische Sesshaftigkeit, die identität- und heimatstiftende »mobile« Behausung quasi von Ort zu Ort bewegend. Im Rückgriff auf literarische Texte von Goethe über Rilke bis Kafka analysiert Holthusen die Situation des modernen Menschen in seinem Geworfensein schlechthin, verbunden mit einer zwangsläufigen Loslösung von alten geistigen Ordnungen. Der »unbehauste Mensch« steht insofern auch als Symbol für die Zerbrechlichkeit behausten Existierens. »Hausen« ist keine Selbstverständlichkeit. Das verdeutlicht der als Flüchtling Unbehauste genauso wie der im Krieg ausgebombte Unbehauste oder der Obdachlose als – in der Regel – Opfer der modernen Leistungs-, Überfluss- und Konsumgesellschaft.
Behaustsein ist das Ergebnis eines umfassend-schöpferischen Prozesses in und an den Wirklichkeiten unserer Welt und wird so als Wirkung wiederum selbst zum kulturellen, sozialen, politischen, ökonomischen und ökologischen Element des Wirklichen. Diese Wirkung kann auch beschrieben werden als umfängliche Arbeit des Menschen an der Welt; sie beinhaltet im Ergebnis das So-und-nicht-anders-Sein des Menschen in einer Zeit und an einem Ort. In diesem existentiellen Sinn schreibt Martin Heidegger: »Bauten behausen den Menschen.« Und weiter: »Das althochdeutsche Wort für bauen, ›buan‹, bedeutet Wohnen. Dies besagt: bleiben, sich aufhalten … Die Art, wie du bist und ich bin, die Weise, nach der wir Menschen auf der Erde sind, ist das Buan, das Wohnen. Mensch sein heißt: als Sterblicher auf der Erde sein, heißt: wohnen.« Schließlich erwächst aus dem Hausen aber, Heidegger folgend, auch eine doppelte Verpflichtung zum Bewahren der Schöpfung vor Schaden und zur Vermeidung von Bedrohungen: »Der Grundzug des Wohnens ist … Schonen. Er durchzieht das Wohnen in seiner ganzen Weite. Sie zeigt sich uns, sobald wir daran denken, dass im Wohnen das Menschsein beruht, und zwar im Sinne des Aufenthalts der Sterblichen auf der Erde.« Und diese Erde gelte es zu bewahren, nicht zuletzt vor Missbrauch durch den Menschen und seine Technik.
Читать дальше