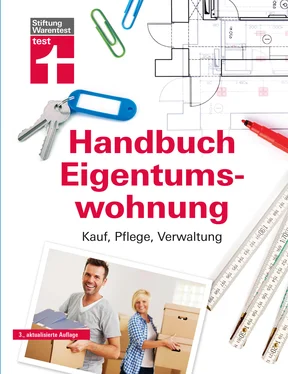Der § 93 BGB verbietet nun aber, an wesentlichen Bestandteilen einer Sache besondere Rechte zu begründen. Darum hat das Wohnungseigentumsgesetz 1951 eine Abweichung vom BGB ausdrücklich festgeschrieben. Dazu musste zunächst das Wohnungseigentum, das es bis dahin gar nicht gab, juristisch definiert werden. „Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört“, heißt es in § 1 des Gesetzes.
Damit unterscheidet sich die Wohneigentümergemeinschaft substanziell von einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder einer anderen Personengesellschaft. Auch zu Eigentümergemeinschaften in anderen europäischen Ländern gibt es Unterschiede. So existiert in Dänemark neben der ejerbolig (Eigentumswohnung) auch die private andelsbolig (Anteilswohnung) – sie wird manchmal unzutreffend als „Genossenschaftswohnung“ übersetzt. Man erwirbt zum Beispiel für umgerechnet 140 000 Euro Anteile am Vermögen der andelsboligforening (der Wohnungsanteilsgemeinschaft) und damit gleichzeitig das Recht, eine Zweizimmerwohnung von 60 Quadratmetern zu nutzen. Das Nutzungsentgelt im gewählten Beispiel ist wesentlich geringer als der Mietzins für eine vergleichbare Wohnung (im gewählten Beispiel etwa umgerechnet 220 Euro). Der Nutzer erwirbt aber kein Eigentumsrecht an der Wohnung selbst, sondern nur Anteile am Gesamtvermögen der Anteilsgemeinschaft und einen Nutzungsanspruch für die Wohnung.

Eine der ältesten Eigentümergemeinschaften bewohnte die Burg Eltz.
Die Probleme der Aristokraten
Schon im Mittelalter standen Adelsfamilien manchmal vor der Tatsache, dass mehrere Erben ein und dieselbe unteilbare Sache besaßen – seit altdeutscher Zeit existierte das Rechtsinstitut der Ganerbschaft.
Erbten beispielsweise mehrere Zweige einer Familie eine Burg gemeinschaftlich, so konnten sie auch nur gemeinschaftlich darüber verfügen. Auf der sogenannten Ganerbenburg mussten die verschiedenen Erben miteinander auskommen, bis zu einem gewissen Grad kooperieren, um nebeneinander friedlich zu koexistieren. Um den Alltag des Nebeneinanders verschiedener Familienzweige, die Fragen der Zugangswege und der Nutzungsrechte an gemeinschaftlichen Bauteilen zu regeln, wurde meist ein sogenannter Burgfrieden geschlossen – dieses Rechtsinstitut ist als Begriff (beispielsweise für innerbetriebliche Kompromisse) in unseren alltäglichen Sprachgebrauch eingegangen. Burgfriedensverträge entsprachen in mancher Hinsicht den heutigen Teilungserklärungen, die das Wohnungseigentum begründen.
Die vielleicht bekannteste Ganerbenburg ist die Burg Eltz in Rheinland-Pfalz. Ihr Bild zierte einst die Rückseite der 500-DM-Banknote.
Hier erbten 1268 drei Linien der Familie die Burg gemeinschaftlich und mussten sich miteinander arrangieren: Eltz vom Goldenen Löwen (Kempenich), Eltz vom Silbernen Löwen (Rübenach) und Eltz von den Büffelhörnern (Rodendorf). Die drei Familienzweige bewohnten einerseits separate Teile der Burg, nutzten aber auch andere Teile der Anlage als Gemeinschaftseigentum. Die von den Büffelhörnern starben 1440 aus; ihr Anteil wurde unter die beiden Löwenfamilien aufgeteilt. Aber erst 1815 kaufte ein Goldener Löwe die Anteile eines Silbernen Löwen und brachte damit die gesamte Burg in seinen eigenen Besitz.
Deutschland ist ein Mieterland. Das selbstgenutzte Wohneigentum ist hier weniger verbreitet als bei manchen unserer west- und nordeuropäischen Nachbarn. Das ist zunächst einmal kein Werturteil, sondern nur die Beschreibung europäischer Verschiedenartigkeit. Und diese Verschiedenartigkeit hat historische Ursachen. Für Deutschlands besondere Situation erlangen mindestens zwei dieser Ursachen besondere Bedeutung.
Die erste Ursache liegt im späten 19. Jahrhundert. Nach den Einigungskriegen 1864 (gegen Dänemark), 1866 (gegen Österreich) und 1870/71 (gegen Frankreich) und der Reichsgründung entwickelte sich Deutschland zur Industrienation. Zwischen 1880 und 1900 entstanden die großen industriellen Ballungszentren. Deren Arbeitskräftehunger ließ viele Städte fast explosionsartig anschwellen. Um 1900 war Deutschland schon ein Mieterland. Der Massenwohnungsbau namentlich in den Großstädten, der um 1880 verstärkt eingesetzt hatte, trug dem enormen Arbeitskräftebedarf der forcierten Industrialisierung Rechnung. Die Einwohnerzahl von Berlin überschritt 1877 die Millionengrenze; 1890 wohnten 1 578 794 Menschen in Berlin, 1905 waren es 2 040 148. Nach dem Zusammenschluss mit den umliegenden Städten und Gemeinden zu „Groß-Berlin“ stieg die Einwohnerschaft sprunghaft, 1925 überschritt sie die Viermillionengrenze.
In den meisten Industriestädten zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Einwohnerschaft von Essen verdoppelte sich innerhalb eines Jahrzehnts von 1895 bis 1905. Die Einwohnerzahl Hamburgs wuchs von 323 000 im Jahr 1890 auf 705 000 im Jahr 1900 und überschritt 1912 die Millionengrenze.
Die zuziehenden Arbeitskräfte hätten weder genügend Fläche vorgefunden, um sich darauf ihre eigenen Häuser zu bauen, noch wären sie dazu wirtschaftlich in der Lage gewesen. Der Wohnungsbedarf wurde überwiegend mit Geschossbauten befriedigt. Wegen der Gleichförmigkeit der Bebauung, der hohen Bebauungsdichte und der oftmals sehr spartanischen Ausstattung sprach man von Mietskasernen. Ganze Stadtquartiere wurden damit bebaut. Die hygienischen Verhältnisse waren oftmals schwierig, und die Ordnungspolizei hatte mehr als einmal Anlass, gegen unzumutbare gesundheitsschädliche Wohnverhältnisse einzuschreiten. Der Grafiker Heinrich Zille wurde um 1900 zum bekannten künstlerischen Chronisten der prekären Wohnverhältnisse Berlins.
Auch die Akten der Baupolizeibehörden sind voll von Klagen und behördlichen Eingriffen wegen unerlaubter Überbauung, unzureichender Lüftung, miserabler Sanitäreinrichtungen, nicht genehmigter Gewerbebetriebe und vieler anderer Mängel, die das Leben in den Mietskasernen um 1900 kennzeichnen. In den übrigen Großstädten des Deutschen Reiches sah es nicht grundlegend anders aus.
Der Anteil des genossenschaftlichen Wohnungsbaus war bis zum Ersten Weltkrieg noch relativ gering. Die sehr schnelle, gewissermaßen nachzuholende Industrialisierung Deutschlands hatte eine extreme Zunahme der Bevölkerungskonzentration zur Folge, und die wurde in wilhelminischer Zeit überwiegend vom privat finanzierten Mietwohnungsbau aufgefangen. Das ist eine Besonderheit gegenüber den europäischen Nachbarstaaten, in denen sich andere Eigentumsformen auch in den Großstädten schon früher durchsetzten.
Eine zweite Ursache ist der deutsche Mietwohnungsmarkt selbst. Er ist zwar reguliert, aber er funktioniert im europäischen Vergleich außerordentlich gut. Über Jahrzehnte ist es mittels Gesetzgebung und fiskalischer Steuerung gelungen, einen Interessenausgleich zwischen den Marktteilnehmern zu erreichen und dieses Gleichgewicht bei allen Schwankungen und trotz starker Interessenskonflikte in den Ballungsgebieten bis heute zu erhalten. Der Wohnungsmarkt besitzt in Deutschland eine starke soziale Komponente, aber er lebt nicht ausschließlich von diesen Sozialbindungen. Im europäischen Vergleich besitzen Mietwohnungen in Deutschland auch einen hohen Standard.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in den Westzonen für 14,6 Millionen Haushalte nur 9,4 Millionen Wohnungen. Der Fehlbestand war im Grunde noch größer, denn in die Summe der „Wohnungen“ waren Behelfsheime wie Baracken und Gartenlauben eingeschlossen. Fünf Personen teilten sich statistisch gesehen eine Wohnung, pro Person standen 15 Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung. Drei alternative Wege der Wohnungsbauförderung boten sich an:
Читать дальше