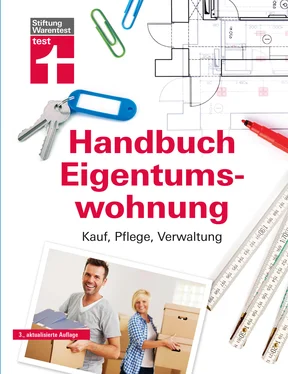Eventuelle Zusatzsicherheiten
Auszahlung des Darlehens
EIGENTUMSWOHNUNG FÜR SELBSTNUTZER
Vergleich „Eigentum statt Miete“
Finanzierung für Selbstnutzer
Hohe Eigenkapitalquote
Eigenkapitalersatzmittel
KfW-Mittel für Selbstnutzer
Finanzierungs-Mix für Selbstnutzer
KfW-Mittel für Sanierung und Energieersparnis
Wohn-Riester
Nachgelagerte Besteuerung der Wohn-Riester-Rente
Finanzielle und steuerliche Hilfen
Steuervergütung für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen
Steuerersparnis für häusliches Arbeitszimmer
Denkmal-Abschreibung
Bausparförderung
Lastenzuschuss für bedürftige Selbstnutzer
Bafa-Zuschuss für neue Ökoheizung
Mittel von Ländern, Kommunen und Kirchen
Belastung aus Bewirtschaftung
Betriebskosten
Verwaltungskosten
Instandhaltungskosten und -rücklagen
Belastung aus Bewirtschaftungskosten
Gesamtbelastung aus Bewirtschaftung und Kapitaldienst
Sinkende Belastung durch Sondertilgungen
VERMIETETE WOHNUNG ALS KAPITALANLAGE
Von der Miete zur Rendite
Mietrenditen brutto und netto
Vermietete Wohnung richtig finanzieren
Niedrige Eigenkapitalquote
Niedriger Tilgungssatz
Zinsbindungsdauer 10 Jahre
Belastung aus Kapitaldienst
Steuern sparen als Vermieter
Steuerersparnisse durch Verluste aus Vermietung
Steuern sparen mit Verlusten
Steuerpflichtige Mieteinnahmen inklusive Umlagen
Steuerlicher Schuldzinsenabzug
Steuerlich abzugsfähige Bewirtschaftungskosten
Steuerlich abzugsfähige Abschreibungen (inklusive Denkmalschutz-AfA)
Steuerfreier Veräußerungsgewinn bei Verkauf
Vermietung und Bewirtschaftung
Objektauswahl
Mietersuche und -auswahl
Mietpreiskalkulation
Mietvertrag
Betriebskostenabrechnung und Mietverwaltung
Kündigung wegen Eigenbedarfs des Vermieters
Vorgehen bei Mietrückständen
VERWALTUNG VON EIGENTUMSWOHNUNGEN
Grundlagen für die Verwaltung
Der Aufteilungsplan
Die Teilungserklärung
Die Gemeinschaftsordnung
Das Gemeinschaftseigentum verwalten
Rechtliche Grundlagen
Neue Rechtsbeziehungen in der Gemeinschaft
Die Organe der Verwaltung
Verwaltung durch die Wohnungseigentümer
Bauliche Veränderungen und Kostentragungspflichten
Verwaltung durch den Wohnungseigentumsverwalter
Gesetzlich unabdingbare Aufgaben
Vermögensbericht
Aufgaben und Befugnisse des Verwalters
Verwaltungsmaßnahmen von untergeordneter Bedeutung
Bestellung und Verwaltervertrag
Verwaltung in Eigenverantwortung oder durch den Profi?
Verwaltung durch den Verwaltungsbeirat
Verwaltung des Sondereigentums
WAS IST MEINE WOHNUNG WERT?
Überschlag oder Gutachten?
Wie wird der Wert bestimmt?
Das Vergleichswertverfahren
Das Ertragswertverfahren
Das Sachwertverfahren
Wertmindernde Faktoren
Wertsteigernde Maßnahmen
Die Aufwertung der Wohnung: Planung
Bestandspläne beschaffen
Bestandspläne prüfen
Neue Bestandspläne erstellen
Bestandsplan, Entwurfsplan, Genehmigungsplanung
Fachleute – Sachverständige – Experten
Die Maßnahmen- und Leistungsbeschreibung
Ausführungsplanung
Ausschreibung und Einholen der Angebote
Das Bauvertragsrecht
Die Vergabe der Arbeiten
Bauleitung und Qualitätskontrolle
Der Bauzeitenplan
Das Bautagebuch
Bauleitung
Qualitätssicherung
Abnahme und Dokumentation
Dokumentation – mehr als eine Formalie
Energieeffizient im Bestand
Neuralgischer Punkt: Die Fenster
Kontrollierte Wohnraumlüftung
Fassadendämmung oder Innendämmung
Energieausweis im Bestand
Nachrüstpflichten
In guten und in schlechten Zeiten
Was geschieht im finanziellen Härtefall?
SERVICE
Glossar
Literatur
Register
VOM NUTZEN EINER EIGENTUMSWOHNUNG

Unter den Begriff Eigenheim fällt neben dem selbstbewohnten Ein- oder Zweifamilienhaus auch die selbstgenutzte Eigentumswohnung.
Der Trend zum Wohnungseigentum hält an. Nach einer Allensbach-Umfrage vor einigen Jahren liegt das Eigenheim als Baustein der Altersvorsorge sowohl bei der Beliebtheit als auch bei der Frage nach einer besonders sicheren Form der Altersvorsorge bei den Bundesbürgern an erster Stelle.
Unter Eigenheim sind die vom Wohnungseigentümer selbstbewohnten und damit eigenen vier Wände zu verstehen. Zum Eigenheim in diesem Sinne zählt neben dem selbstbewohnten Ein- oder Zweifamilienhaus auch die selbstgenutzte Eigentumswohnung. Drei Viertel der Selbstnutzer wohnen in einem Ein- oder Zweifamilienhaus und ein Viertel in einer Eigentumswohnung.
Erstaunlicherweise liegt die vermietete Wohnimmobilie, also die vermietete Eigentumswohnung oder das Miethaus, bei der Beliebtheit der Altersvorsorgeformen nach dem Eigenheim und Bausparen bereits an dritter Stelle und bei der Bewertung der finanziellen Sicherheit mit immer noch 32 Prozent hinter dem Eigenheim (52 Prozent), der gesetzlichen Rente (45 Prozent) und der betrieblichen Rente (35 Prozent) an vierter Stelle.
WIE ENTSTAND DAS WOHNUNGSEIGENTUM?
Das Eigentum an einer Wohnung ist ein relativ junges Rechtskonstrukt. Es entstand in Deutschland erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit dem Wohnungseigentumsgesetz von 1951 wurden in der Bundesrepublik Deutschland die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen. In der DDR, wo es zwar auch privat genutztes Wohneigentum und in den Fünfzigerjahren sogar zeitweilig das Bausparen gab, war das Privateigentum an einer einzelnen Wohnung hingegen unbekannt.
Das Eigentum an einer Wohnung in einem Gebäude, das mehrere Wohnungen umfasst, wäre nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch eigentlich nicht möglich. Denn – vereinfacht gesprochen – das Gebäude und der Grund, auf dem es steht, bilden eine untrennbare Einheit. Aus § 93 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), der „Wesentliche Bestandteile einer Sache“ definiert, geht hervor: „Bestandteile einer Sache, die voneinander nicht getrennt werden können, ohne dass der eine oder andere zerstört oder in seinem Wesen verändert wird (wesentliche Bestandteile), können nicht Gegenstand besonderer Rechte sein.“ Und auf das Verhältnis von Grundstück und Gebäude bezogen heißt es in § 94 BGB ausdrücklich: „Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks gehören die mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen, insbesondere Gebäude … Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebäudes gehören die zur Herstellung des Gebäudes eingefügten Sachen.“
Ein Gebäude ist in der Regel (Ausnahmen davon gibt es natürlich) nicht aus einzelnen Wohnungen quasi modular zusammengesetzt, sondern ein Ganzes, das nicht real in mehrere kleinere Einheiten, also eben Wohnungen, zerlegt werden kann. Genauso unmöglich ist, das Grundstück, auf dem das gesamte Gebäude steht, real den einzelnen Wohneinheiten zuzuordnen. Auf welchem Teil des Grundstücks ruht beispielsweise die Wohnung im dritten Obergeschoss rechts? Natürlich auf derselben Fläche wie auch die Wohneinheiten unter dieser Wohnung vom Erdgeschoss bis zum zweiten Obergeschoss. Eine Realteilung wäre hier gar nicht möglich. Auch dass sich ein Gebäude, das mit dem Grundstück fest verbunden ist, vom Grund und Boden real nicht trennen lässt, ohne das Gebäude wesentlich zu verändern oder gar zu zerstören, leuchtet ein. Von dem Sonderfall, dass man mit aufwendigen technischen Hilfsmitteln ein komplettes Gebäude von seinem Fundament trennen und an eine andere Stelle versetzen kann, darf in diesem Zusammenhang abgesehen werden.
Читать дальше